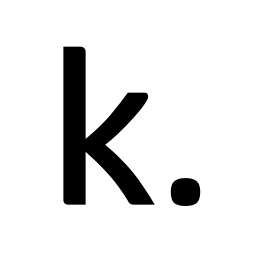Sozialraum
Wie können wir schwer erreichbare Klienten mit psychischen Beeinträchtigungen dabei unterstützen, echte Beziehungen im Sozialraum aufzubauen?
In diesem Essay entwerfe ich unter dem Motto “Beziehungen, nicht Adressen” die Grundzüge eines Konzepts zum sozialraumorientierten Empowerment schwer erreichbarer Klientel aus Perspektive der Fachkräfte eines freien Trägers der Eingliederungshilfe.
Im ersten Teil befasse ich mich der Ausgangssituation, im zweiten Teil mit den konzeptionellen Ausgangspunkten und im dritten Teil mit einer groben Skizze einer möglichen Umsetzung.
Problem: Mittendrin und doch völlig ausgeschlossen
Ein Sozialraum besteht primär aus Beziehungen, nicht aus Adressen. Leicht schauen wir bei der Umsetzung der Sozialraumorientierung auf Adressen: Wo sind Ärzte, Kliniken, Beratungsstelle, Tagesstätten, Arbeitsangebote, Selbsthilfegruppen, Sportvereine und vieles mehr. Doch kommen unsere Klient*innen dorthin, so merken sie schnell: Willkommen sind sie hier nicht. Die Arzthelferin schmeißt sie raus und ruft ihnen hinterher, beim nächsten Mal mit ihrer Betreuerin zu kommen, die Tagesstätte hat keinen Platz für unangemeldete Besucher*innen, die Selbsthilfegruppe erwartet etwas mehr Anpassung und gelegentliche Redepausen, und im Sportverein geht in den ersten drei Minuten so gut wie alles schief, was nur schiefgehen kann.
Kaum eine psychisch stark beeinträchtigte, als „schwer erreichbar“ (Corda-Zitzen & Schax, 2023; Giertz, Große & Gahleitner, 2021) geltende Person fühlt sich in ihrem Sozialraum willkommen. Rückzug in die eigenen vier Wände folgt schnell den gescheiterten zwischenmenschlichen Beziehungen. Der Rückzug wird zur persönlichen Schutzstrategie gegenüber einer Umwelt, die als überfordernd wahrgenommen wird (Kal, 2022, S. 167). So wird aus einem Sozialraum ein beziehungsloser Raum, in dem alles möglich scheint und nichts möglich ist. Zur Unterstützung springen professionelle Helfer*innen ein, „umzingeln“ (Dörner zitiert nach Görres & Zechert, 2009, S. 10) die Hilfsbedürftigen, lassen Sozialraumorientierung aus der Not hinter sich und fördern am Ende nur eins: Einsamkeit. Statt die Mauern der Institutionalisierung abzubauen, sind infolge der Deinstitutionalisierung vielerorts „die Mauern einfach nur unsichtbar(er) geworden“ (Seckinger & Neumann, 2019, S. 520). Hinter diesen Mauern bleibt „ein hilfebedürftiges, saft- und kraftlos anmutendes etwas namens Klient übrig, umfeldentwurzelt und ins Treibhaus wohlmeinender Einzelfallhilfe umgetopft“ (Früchtel & Budde, 2006, S. 202).
Der Bezirk Steglitz-Zehlendorf kann allein etwa hundert Selbsthilfegruppen aufweisen (SEKIS, 2023), hinzu kommen mehrere Beschäftigungstagesstätten, Kontakt- und Beratungsstelle, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen sowie zahlreiche Sport- und Kulturvereine und Nachbarschaftszentren (Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, 2024a, 2024b). Doch zugänglich sind diese sozialräumlichen Angebote für schwer erreichbare Klientel erfahrungsgemäß nicht. Viele haben so gut wie jedes mögliche Angebot ausprobiert. Und immer wieder das Gleiche: Rauswurf oder freiwilliger Rückzug. Menschen mit chronischen psychischen Beeinträchtigungen blieben doch immer wieder außen vor (Seckinger & Neumann, 2019, S. 526).
Impuls: Sozialräumliche Willkommenskultur
Auch lässt sich ein weiteres Bild zeichnen. In zahlreichen Terminbegleitungen und Spaziergängen durch den Sozialraum habe ich immer wieder eine Überraschung erlebt: Viele der Klient*innen pflegen im Sozialraum beständige Kurzkontakte. Sie haben sich ein relativ langlebiges Netzwerk aufgebaut, das von zeitlich begrenzten, auf allen Ebenen unverbindlichen Interaktionen besteht. Ihre Nachbarschaftskontakte sind zuvorderst Bedienungen in Imbissen und Verkäufer*innen im Einzelhandel, manchmal auch Passant*innen, die sie Tag für Tag auf ihren Spaziergängen durch den Sozialraum treffen. Sie sind namentlich bekannt und gerne gesehen. Es ist wichtig, zu bemerken, dass die Kontakte nur wenige Minuten dauern: lang genug, um in Kontakt zu kommen, nicht lang genug, um in Konflikte zu geraten. Diese Kontakte sind so stabilisierend und verbindlich, dass Tränen fließen, wenn eine Person nicht mehr in der Nachbarschaft arbeitet. Eine Einbindung den informellen dritten Sozialraum der Nachbarschaft (Dörner, 2007, S. 92) findet bei vielen unbemerkt statt. Wir Fachkräfte werden überrascht, wenn wir die gewachsenen Bindungen entdecken. Wie kann diese Einbindung unter Berücksichtigung der Schwere der Beeinträchtigung unserer Klient*innen aktiv gefördert werden? Wie können weitere Partizipationsmöglichkeiten im Sozialraum geschaffen werden, die „als Voraussetzung von Verrückten nicht verlangen, ihre Verrücktheit aufzugeben“ (Seckinger & Neumann, 2019, S. 530)?
Impulse dazu finden sich in der sozialräumlichen Willkommenskultur des niederländischen Konzepts „Kwartiermaken“ (deutsch: “Kiezmachen” in meiner ureigenen Übersetzung). In den Niederlanden ist das Konzept in den vergangenen drei Jahrzehnten zu einer Bewegung gewachsen (Görres & Zechert, 2009, S. 133). Es fördert eine inklusive Gesellschaft, die im Sozialraum eine förderliche Umgebung für Andersartigkeit schafft und Menschen mit psychischen Problemen oder Behinderungen bei der sozialen Wiedereingliederung unterstützt (Görres & Zechert, 2009, S. 134; Kal, 2016, S. 46). Kiezmachen „takes you from healthcare provider to hope provider“ (Dierinck, 2023a, S. 124): Leistungserbringende werden zu Hoffnungsträger*innen, die mit den Klient*innen an einem Traum der lebendigen und wechselseitigen Integration psychisch Beeinträchtiger in die Nachbarschaft arbeiten (S. 124f.). Dreh- und Angelpunkt in der Konzeptumsetzung ist ein „Kwartiermaker“ oder “Kiezmacher”. Diese Person ist gleichzeitig Wegbereiter*in, Netzwerkentwickler*in und Kampagnenführer*in (Kal, 2022, S. 18) und hilft der einer von Ausgrenzung Betroffenen, zusammen mit freiwilligen Unterstützer*innen ihren Platz im Sozialraum zu finden und zu entwickeln. Diese Freiwilligen können Ansprechpartner*innen in Vereinen oder Gruppen sind, aber auch vermittelte „Freund*innen“, die einer Klient*in für ein paar Stunden jede Woche zur Seite stehen. Essenziell dabei: die Beziehungsorientierung, bei der es um den Aufbau und Erhalt von Beziehungen und Gemeinschaft geht (Doose, 2020, S. 18). Das ist gar nicht so leicht. In einer Zeit, in der nachbarschaftliche Beziehungen kaum noch üblich sind und der dritte Sozialraum als überholt abgewertet wird (Dörner, 2007, S. 92f.), stellt es erst einmal eine Überwindung dar, den engsten Kreis der familiären und professionellen Helfer*innen zu verlassen und die Unterstützung von Menschen aus der Nachbarschaft oder dem Stadtviertel in Anspruch zu nehmen (S. 98f.). Ein Unterstützer*innenkreis aus professionellen Helfer*innen, Familienmitgliedern und Ehrenamtlichen, wie er in der Persönlichen Zukunftsplanung nach Doose vorgeschlagen wird (S. 100ff.), kann beim Beziehungsaufbau helfen. Sowohl Unterstützer*innenkreise als auch Kiezmachen regen an, Beziehungen zwischen „Verrückten“ und „Normalen“, zwischen Nachbar*innen jenseits normativer Abgrenzungen in den Mittelpunkt zu stellen und damit bislang Ausgeschlossene im Sozialraum willkommen zu heißen (Doose, 2020, S. 118ff.; Kal, 2022, S. 49f.).
Wie kann, basierend auf diesen Impulsen, ein konkretes Empowerment-Konzept für die Entwicklung von Beziehungen im Sozialraum aussehen?
Konzept: Moderierte Beziehungen, gemeinschaftlicher Sozialraum
Im organisatorischen Mittelpunkt des sozialräumlichen Empowerment-Konzeptes stehen Fachkräfte in einer neuen Rolle als Sozialraum-Moderator*innen. Besser: im Hintergrund. Sie moderieren die Aktivitäten von Freund*innen und Unterstützer*innen der Betroffenen. Freund*innen, Unterstützer*innen und allen voran die Betroffene stehen im Mittelpunkt auf der Reise in einen neu zu erschließenden Sozialraum.
Sozialraum-Moderator*innen
Als Fachkräfte lassen wir unsere Rollen als Bezugsbetreuer*innen, Sozialarbeiter*innen, Fallmanager*innen hinter uns und schlüpfen in eine neue Rolle: Sozialraum-Moderator*innen. Dabei betreuen wir weder unsere Klient*innen, noch managen wir den Sozialraum. Wir moderieren einen Beziehungs- und Entdeckungsprozess. Wir bereiten Wege. Wir bringen Menschen zusammen. Wir entwickeln Netzwerke.
Die Rolle der Sozialraum-Moderator*in lehnt sich an die Rolle des Kiezmachers an, der mit allen Beteiligten Gespräche führt und sie miteinander ins Gespräch bringt. Er ist in Kontakt mit den Stakeholdern der lokalen sozialpsychiatrischen Versorgungslandschaft und baut Verbindungen in Vereine und Organisationen auf, er ist „Wegbereiter, Kampagnenleiter und Netzwerkentwickler“ (Görres & Zechert, 2009, S. 135f.). Vor allem entwickelt er die Teilnahme ehrenamtlicher Unterstützer*innen (Kal, 2022, S. 79ff.) und unterstützt gemeinsam mit ehrenamtlichen Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen die Teilnahme an Angeboten des Sozialraums, ohne dass diese Ihre Andersartigkeit aufgeben müssten. Als Fachkräfte ebnen sie den Weg ihrer Klientel aus sozialpsychiatrischen Angeboten heraus – hinein in reguläre Angebote wie Klubs, Vereine und Nachbarschaftszentren (Seckinger & Neumann, 2019, S. 531).
Freund*innen-Projekte
Die Sozialraum-Moderator*innen stellen Kontakte zu zwei unterschiedlichen Arten von „Freund*innen“ her: einerseits zu einem Pool an Ehrenamtlichen, die jeweils feste Paare mit einer psychisch belasteten Person bilden und im Rahmen sog. „Freundschaftsdienste“ ein paar Stunden ihrer Zeit jede Woche geben (Dierinck, 2023a, S. 120ff. und 134ff.; Kal, 2022, S. 178), und anderseits zu festen Kontaktpersonen in Institutionen des Sozialraums, wie in Sportvereinen, Chören oder Volkshochschule, um den Weg in diese Institutionen zu erleichtern, gewissermaßen als „Paten (oder Mentoren) vor Ort“, die bei Bedarf und bei Problemen da sind, sich sonst aber im Hintergrund halten (S. 43). Die Ehrenamtlichen schaffen einen gastfreundlichen Raum und unterstützen beim Ausprobieren von Fähigkeiten und der Übernahme von Verantwortung (Görres & Zechert, 2009, S. 135f.).
Unterstützer*innen-Netzwerke
Die individuelle Unterstützung soll durch intensive Netzwerkaktivitäten ergänzt werden, basierend auf Praktiken des Kiezmachens bzw. Kwartiermakens, ergänzt durch Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung.
Regelmäßige Treffen von engagierten Bewohner*innen der Nachbarschaft und Akteuren der Zivilgesellschaft mit den zuständigen sozialarbeiterischen Fachkräften bieten einen Raum zum Besprechen von auftretenden Problemen, fördern den Dialog und tragen zu einer Entstigmatisierung und Normalisierung im Zusammenleben bei (Dierinck, 2023a, S. 115f., 2023b). Ein Netzwerk an Schlüsselpersonen im Stadtteil kann über sog. One-to-Ones aufgebaut werden (Früchtel & Budde, 2006, S. 214). Vor allem für Krisensituationen kann eine Nachbarschaftshotline angeboten werden, an die sich besorgte Nachbar*innen wenden können und jederzeit fachkundigen Rat bekommen (Dierinck, 2023a, S. 116f.). Mit dem Angebot von Multilog-Gruppen (Dierinck, 2023a, S. 133) oder moderierten Unterstützer*innen-Kreisen (Doose, 2020, S. 97ff.; Roerick, 2023, S. 8ff.) werden die verschiedenen professionellen und ehrenamtlichen Unterstützer*innen einer Klient*in an einen Tisch gebracht und unterstützen sie, z. B. mit Hilfe von Techniken der Persönlichen Zukunftsplanung, bei der Findung von Ideen und Wünschen für ihre eigene Zukunft. Dabei geht die Tätigkeit der Unterstützer*innenkreise weit über die reine Zukunftsplanung hinaus. Als langfristiges Instrument begleiten sie die Verwirklichung von Zielen der Klient*in – beratend und auch ganz praktisch als „Freund*innen“ im Sinne der oben genannten Freundschaftsdienste oder als „Pat*innen/Mentor*innen“ in Angeboten des Sozialraums.
Fazit
Wenn wir sagen, dass „der Rang von sozialen Beziehungen im Rehabilitationsprozess psychisch beeinträchtigter Menschen“ nicht zu unterschätzen ist (Seckinger & Neumann, 2019, S. 522), dann ist Kiezmachen ein Weg, langfristige soziale Beziehungen im Sozialraum zu entwickeln.
Wir können auf Entscheidungen der Politik warten, einen lokalen Kiezmacher nach niederländischem Vorbild anzustellen und einen sozialräumlichen Veränderungsprozess zu starten. Oder wir können aus unserer Einrichtung heraus starten und als Teilzeit-Kiezmacher mit unseren Klient*innen den Sozialraum erschließen.
Fangen wir als Fachkräfte, mit Methoden des Kiezmachens und verwandten Methoden Beziehungen und Gemeinschaft im Sozialraum zu moderieren, so öffnen wir in vielen kleinen Schritten den bislang verschlossenen Zugang zur sozialen Teilnahme für unsere Klient*innen und bieten ihnen eine Basis für nachhaltiges, sozialraumorientiertes Empowerment, das nicht nur eine Bereicherung für die Klient*innen ist, sondern auch für die Nachbarschaft, die Vielfalt und Verrücktheit mit offenen Armen empfangen lernt.
Literaturverzeichnis
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. (2024a). Freizeitmöglichkeiten in Steglitz-Zehlendorf. Zugriff am 7.7.2024. Verfügbar unter: https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/auf-einen-blick/freizeit/
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. (2024b). Die wichtigsten Beratungsstellen im Bezirk. Zugriff am 7.7.2024. Verfügbar unter: https://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/beauftragte/integration/artikel.1070760.php
Corda-Zitzen, S. & Schax, D. (2023). „Hard to reach“ – verschiedene Perspektiven auf den Begriff. Soziale Psychiatrie, 47(2), 12–14.
Dierinck, P. (2023a). Community-Based Mental Healthcare for Psychosis. From Homelessness to Recovery and Continued In-home Support. London, New York: Routledge.
Dierinck, P. (2023b). Quartermaking: method to create hospitality and inclusion. International Journal of Integrated Care, 23(S1), 107.
Doose, S. (2020). „I want my dream“ - Persönliche Zukunftsplanung (11. Auflage). Neu-Ulm: AG SPAK Bücher.
Dörner, K. (2007). Leben und sterben, wo ich hingehöre: Dritter Sozialraum und neues Hilfesystem. Neumünster: Paranus.
Früchtel, F. & Budde, W. (2006). Wie funktioniert fallunspezifische Ressourcenarbeit? Sozialraumorientierung auf der Ebene von Netzwerken. In W. Budde, F. Früchtel & W. Hinte (Hrsg.), Sozialraumorientierung. Wege zu einer veränderten Praxis (S. 201–218). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Giertz, K., Große, L. & Gahleitner, S. B. (2021). Hard to reach: Schwer erreichbare Klientel unterstützen. Köln: Psychiatrie Verlag.
Görres, B. & Zechert, C. (2009). Der dritte Sozialraum als Handlungsort gemeindepsychiatrischer Organisationen. Köln: Psychiatrie Verlag.
Kal, D. (2016). Raum für Andersartigkeit. Das niederländische Konzept Kwartiermaken und sein philosophischer Hintergrund. sozialpsychiatrische informationen, 46(2), 45–50.
Kal, D. (2022). Gastfreundschaft. Das niederländische Konzept Kwartiermaken. Köln: Psychiatrie Verlag.
Roerick, J. (2023). Persönliche Zukunftsplanung mit erwachsenen Systemsprenger*innen (Hausarbeit). Berlin: Alice Salomon Hochschule. Zugriff am 5.7.2024. Verfügbar unter: https://1drv.ms/b/s!AhFUroBoPju0gZVgDMUEf3AjjeERLQ?e=jjUNCT
Seckinger, M. & Neumann, O. (2019). Sozial- und Gemeindepsychiatrie als sozialraumbezogenes Handlungsfeld. In F. Kessl & C. Reutlinger (Hrsg.), Handbuch Sozialraum. Grundlagen für den Bildungs- und Sozialbereich (2. Auflage, S. 520–537). Wiesbaden: Springer VS.
SEKIS. (2023). Kontaktstellen Steglitz-Zehlendorf. SEKIS Zentrum für Selbsthilfe und das Engagement rund um die Pflege in Berlin. Zugriff am 21.6.2024. Verfügbar unter: https://www.sekis-berlin.de/selbsthilfe/kontaktstellen/steglitz-zehlendorf