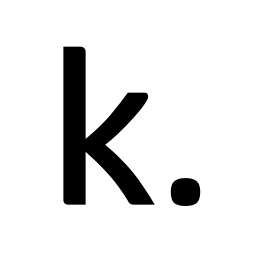Stigmatisierung
Ein Fall aus dem Alltag: Diagnosen und ihre Tücken
Du bist Teil eines Teams in einer Wohngruppe, in der Menschen mit verschiedenen psychischen Herausforderungen zusammenleben. Seit einigen Wochen fällt dir auf, dass deine Kollegin Sandra immer häufiger das Verhalten von zwei Bewohner*innen, Lena und Markus, mit deren Borderline-Persönlichkeitsstörung erklärt.
"Typisch Borderline", hörst du Sandra in der Teambesprechung sagen, als es um Lenas jüngsten Wutausbruch geht. "Die können halt nicht anders." Beim Schichtwechsel erwähnt sie beiläufig: "Markus hat schon wieder seine Termine abgesagt. Aber was erwartest du bei Borderlinern?"
Du merkst, wie sich ein ungutes Gefühl in dir breitmacht. Einerseits verstehst du Sandras Bedürfnis, das herausfordernde Verhalten einzuordnen. Andererseits fragst du dich, ob diese ständige Betonung der Diagnose nicht mehr schadet als nützt.
Die Crux mit den Etiketten
In der nächsten Teamsitzung bringst du das Thema vorsichtig zur Sprache. "Ich frage mich, ob wir Lena und Markus gerecht werden, wenn wir ihr Verhalten immer auf ihre Diagnose zurückführen", sagst du. "Könnte es sein, dass wir dadurch andere Faktoren übersehen?"
Sandra wirkt überrascht. "Aber es ist doch wichtig, dass wir ihre Krankheit verstehen", entgegnet sie. "Das hilft uns, ihr Verhalten einzuordnen."
Du nickst nachdenklich. "Das stimmt. Aber besteht nicht die Gefahr, dass wir sie auf ihre Diagnose reduzieren? Jeder Mensch ist doch mehr als seine psychische Erkrankung."
Zwischen Verständnis und Vorurteil
Eine angeregte Diskussion entbrennt. Ihr sprecht darüber, wie schwierig es sein kann, die Balance zu finden zwischen dem Verständnis für die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung und der Vermeidung von Stigmatisierung.
"Vielleicht sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, was Lena und Markus als Individuen brauchen, statt ihr Verhalten immer mit ihrer Diagnose zu erklären", schlägst du vor. "Welche Ressourcen haben sie? Was hat ihnen in der Vergangenheit geholfen?"
Sandra scheint nachdenklich. "Du hast recht", gibt sie zu. "Ich wollte nie stigmatisierend sein. Ich dachte, es würde uns helfen, ihr Verhalten besser zu verstehen."
Ein neuer Ansatz
Gemeinsam beschließt ihr, in Zukunft bewusster mit Diagnosen umzugehen. Statt pauschal vom "typischen Borderline-Verhalten" zu sprechen, wollt ihr euch auf konkrete Beobachtungen und individuelle Bedürfnisse konzentrieren.
In den folgenden Wochen bemerkst du, wie sich die Atmosphäre in der Wohngruppe verändert. Lena und Markus scheinen mehr Vertrauen zu fassen, als sie merken, dass sie als ganze Menschen wahrgenommen werden – mit all ihren Stärken, Schwächen und individuellen Geschichten.
Du erkennst: Es ist ein schmaler Grat zwischen hilfreichem Fachwissen und unbeabsichtigter Stigmatisierung. Als Sozialarbeiterin ist es deine Aufgabe, diesen Grat bewusst zu beschreiten und immer wieder kritisch zu hinterfragen, wie du über deine Klientinnen denkst und sprichst.