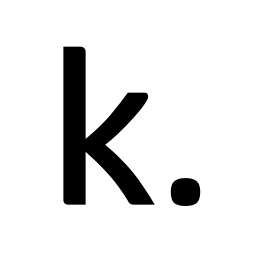Auf Augenhöhe
Wie funktionieren Entscheidungen “auf Augenhöhe”
Die Methode “Auf Augenhöhe” [1] basiert auf Konsent. Für die Sozialarbeit bietet es interessante Ansätze für partizipative Entscheidungsprozesse sowohl in der Einzel- als auch in der Gruppenarbeit, kann in Werkstätten, Wohnheimen und Betreutem Wohnen gleichermaßen genutzt werden.
Warum “auf Augenhöhe”?
Hier ein paar Gründe, warum Entscheidungen mit Klient*innen in der Sozialen Arbeit "auf Augenhöhe" getroffen werden sollten:
1. Förderung der Selbstbestimmung und Autonomie: Eine partizipative Arbeitsweise, bei der Klient*innen als gleichberechtigte Partner*innen in Entscheidungsprozesse einbezogen werden, stärkt deren Selbstbestimmung und Autonomie. So werden die Klient*innen befähigt, selbstbestimmt Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen.
2. Stärkung der Beziehung und des Vertrauens: Durch einen partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe kann eine vertrauensvolle Arbeitsbeziehung zwischen Fachkraft und Klient*in aufgebaut werden. Dies ist eine wichtige Grundlage für eine gute Zusammenarbeit.
3. Nutzung der Expertise der Klient*innen: sie sind “Experten in eigener Sache”. Fachkräfte können ihnen im Dialog auf Augenhöhe helfen, diese Expertise in ihrem Leben zu nutzen, ihre eigenen Ressourcen und Fähigkeiten zu erkennen und zu aktivieren. Dies fördert Selbstwirksamkeit und Problemlösungskompetenz.
4. Umsetzung rechtlicher Vorgaben: Sowohl das Bundesteilhabegesetz als auch internationale Konventionen wie die UN-Behindertenrechtskonvention fordern die Partizipation und Selbstbestimmung von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Eine Arbeitsweise auf Augenhöhe setzt diese rechtlichen Vorgaben um.
5. Umsetzung ethischer Prinzipien: Der Berufskodex der Sozialen Arbeit fordert die Achtung der Würde und Selbstbestimmung der Klient*innen. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe setzt diese ethischen Prinzipien in die Praxis um.
Grundprinzipien
Die Konsent-Methode basiert auf dem Prinzip, dass Entscheidungen getroffen werden, wenn kein Teilnehmer einen schwerwiegenden Einwand gegen einen Vorschlag hat. Diesem Ansatz folgend zielt das Konzept "Auf Augenhöhe" [1] darauf ab, Klient*innen aktiv in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und ihre Perspektiven zu berücksichtigen. Beide Ansätze streben eine gleichberechtigte Teilhabe aller Beteiligten an.
Partizipative Elemente
"Auf Augenhöhe" betont die Wichtigkeit, Klient*innen als Expert*innen für ihr eigenes Leben anzuerkennen. Dies entspricht dem Grundgedanken der Konsent-Methode, alle Stimmen zu hören und zu berücksichtigen.
Entscheidungsfindung
Wie in der Konsent-Methode folgt “Auf Augenhöhe” einem strukturierten Prozess zur Entscheidungsfindung und legt den Fokus auf die Schaffung einer Atmosphäre, in der Klient*innen sich trauen, ihre Meinungen und Bedürfnisse zu äußern. Dies kann als Gesprächstechnik zu einem konsensorientierten Entscheidungsprozess verwendet werden.
Hier ist eine kurze Zusammenfassung der Schritt-für-Schritt-Anleitung [1]:
Spannung benennen: Ein Problem oder Konflikt wird sachlich und ohne Vorwürfe beschrieben. Die Anwesenden können Fragen stellen, um zu verstehen, was los ist.
Vorschlag machen: Die Person, die die Spannung benannt hat, schlägt eine Lösung vor. Sie kann die anderen um Hilfe bei der Formulierung bitten. Jede*r kann Verständnisfragen stellen und es kann ein wohlwollendes Gespräch zum Thema stattfinden.
Einwände sammeln: Alle Beteiligten können Bedenken oder Zweifel äußern. Diese werden auf eine aufgeschrieben, z.B. auf eine Flipchart, damit alle sie gut sehen können.
Einwände integrieren : Die Gruppe versucht, die Einwände in den Vorschlag einzuarbeiten, einen nach dem anderen. Die Integration der Einwände macht den Vorschlag besser. Schwachstellen und Risiken werden gemeinsam überarbeitet.
Entscheidung treffen: Der Vorschlag wird angenommen, wenn keine Einwände mehr bestehen oder alle zufriedenstellend integriert wurden. Bleiben am Schluss noch Einwände, so müssen diese wirklich gut begründet sein. Ein unbegründetes Veto ist kein Einwand.
Wichtige Aspekte:
Die Methode kann bei größeren Problemen detailliert angewendet oder als Haltung in die Gesprächskultur übernommen werden.
Einwände sollten zeitnah geäußert werden, um spätere Überraschungen zu vermeiden.
Bei nicht integrierbaren Einwänden gibt es drei Möglichkeiten: zur Seite stehen, um Aufschub bitten oder den Vorschlag blockieren.
Angenommene, vertagte und abgelehnte Vorschläge können in einem Vorschlag-Buch dokumentiert werden. So kann man später immer wieder darauf zurückgreifen und es gibt weniger Missverständnisse.
Diese Methode fördert eine konstruktive Kommunikation und zielt darauf ab, Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel sind.
Links
[1] https://icf-mobil.berlin/auf-augenhoehe-entscheiden/