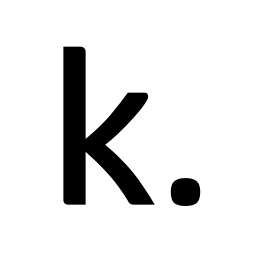Neues Kapitel
Was nun?
Die Rubrik konsent.berlin/fragen wird nicht mehr weitergeführt. Aber hier geht es weiter…
Sozialraum
Wie können wir schwer erreichbare Klienten mit psychischen Beeinträchtigungen dabei unterstützen, echte Beziehungen im Sozialraum aufzubauen?
In einer Welt, in der Menschen mit schweren psychischen Beeinträchtigungen oft am Rande der Gesellschaft stehen, eröffnet ein innovatives Konzept neue Wege zur sozialen Integration. Statt der üblichen Einzelfallhilfe setzt dieses Konzept auf die Kraft der Gemeinschaft und des Sozialraums. Sozialarbeiter schlüpfen in die Rolle von Moderatoren, die Beziehungen zwischen "Verrückten" und "Normalen" fördern. Mit Hilfe von ehrenamtlichen "Freunden" und einem Netzwerk von Unterstützern wird der Sozialraum neu erschlossen. Dabei geht es nicht darum, die Andersartigkeit aufzugeben, sondern einen Platz in der Gemeinschaft zu finden, so wie man ist. Entdecken Sie, wie dieses Konzept den Weg zu einer inklusiveren Gesellschaft ebnet und Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen neue Hoffnung auf echte Teilhabe gibt.
Stigmatisierung
Wie oft machen wir unsere Klient*innen unbeabsichtigt zu ihrer Diagnose?
Täglich begegnen wir Menschen mit psychischen Erkrankungen. Dabei ist es verlockend, ihr Verhalten stets durch die Brille ihrer Diagnose zu betrachten. Doch was passiert, wenn wir Klient*innen unbewusst auf ihre Krankheit reduzieren? Ein Fallbeispiel aus einer Wohngruppe zeigt, wie schnell gut gemeintes Fachwissen zur Stigmatisierung führen kann - und wie wir diesem Dilemma begegnen können.
Gastfreundschaft
Was bedeutet es, in der Sozialen Arbeit wirklich gastfreundlich zu sein?
Nicht nur freundlich, nicht nur professionell – sondern offen, einladend, bereit, Raum zu machen für Menschen, die sonst draußen bleiben.
Ein Plädoyer für mehr offene Türen – und für eine Soziale Arbeit, die den Mut hat, Fremdes willkommen zu heißen.
Kommunikation
Wie sollte eine Gruppenleitung reagieren, wenn ein Teilnehmer etwas Unpassendes sagt?
Das Verziehen des Gesichts kann problematisch sein - aber welche Alternativen gibt es, um eine offene und respektvolle Diskussionsatmosphäre zu fördern?
Foto: Unsplash
Konsent in der Sozialen Arbeit
Wie kann Konsent beispielsweise eingesetzt werden, um Selbstbestimmung und Partizipation zu fördern?
Dieser faszinierende Text stellt die Konsent-Entscheidungsfindung als vielversprechende Methode für die Soziale Arbeit vor. Joel Roerick beschreibt anhand eines konkreten Fallbeispiels aus einer therapeutischen Gärtnerei, wie dieser Ansatz in der Praxis angewendet werden kann, um Konflikte zu lösen und Klient*innen zu mehr Selbstbestimmung zu verhelfen. Der Text zeigt auf, wie Konsent-Entscheidungsfindung zu mehr Partizipation und Empowerment beitragen kann.
Buurtzorg
Ist das Buurtzorg-Modell auf das Betreute Wohnen übertragbar?
Das niederländische Pflegeunternehmen Buurtzorg revolutionierte mit seinem Modell der Selbstorganisation die Hauskrankenpflege. Doch lässt sich dieses Erfolgsrezept auch auf das Betreute Wohnen in der Eingliederungshilfe übertragen? Diese Arbeit analysiert die Merkmale des Buurtzorg-Modells und reflektiert kritisch dessen Anwendbarkeit im Kontext der Sozialen Arbeit. Dabei werden Chancen und Risiken beleuchtet sowie Empfehlungen für eine mögliche Implementierung gegeben. Ein spannender Blick auf innovative Organisationsformen in der Pflege und deren Potenzial für die Eingliederungshilfe.
Grenzen
Wie können Fachkräfte professionelle Grenzen wahren und gleichzeitig den Bedürfnissen ihrer Klient*innen gerecht werden?
Fachkräfte stehen oft vor der Herausforderung, eine Balance zwischen professioneller Distanz und empathischer Nähe zu finden. Ein Fallbeispiel aus einer therapeutischen Wohngemeinschaft zeigt, wie unterschiedliche Erwartungen zu Konflikten führen können. Dieser Artikel untersucht die Komplexität solcher Situationen und bietet Lösungsansätze für eine professionelle Herangehensweise.
Persönliche Zukunftsplanung
Kann Persönliche Zukunftsplanung Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten unterstützen?
Persönliche Zukunftsplanung bietet einen vielversprechenden Ansatz für die Arbeit mit sogenannten "Systemsprenger_innen" Durch den Aufbau von Unterstützer_innenkreisen können Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen und Verhaltensauffälligkeiten neue Perspektiven entwickeln und Isolation überwinden. Dieser Artikel beleuchtet die Chancen und Herausforderungen der Methode und diskutiert ihre Anwendung im sozialarbeiterischen Alltag.
Gemeinschaft
Welche Impulse kann das Camphill-Modell für die Behindertenhilfe geben?
Die Camphill-Bewegung praktiziert seit über 80 Jahren eine einzigartige Form des inklusiven Zusammenlebens von Menschen mit und ohne Behinderungen. Jenseits von institutioneller Betreuung und gemeindenaher Arbeit bietet Camphill einen "Mittelweg zwischen Utopie und Institution". Welche Impulse kann dieses Modell für die Zukunft der Behindertenhilfe geben, insbesondere im Hinblick auf demographische Herausforderungen und den Wunsch nach mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt?
Eigensinn
Ist Unordnung menschenunwürdig?
Wie weit reicht die Verantwortung eines Bezugsbetreuers, um Ordnung zu fördern? Und welche Grenzen hat ein Vorgesetzter bei der Anweisung, die Menschenwürde durch mehr Ordnung zu schützen?
Berufsethik
Freiwillige Ethik oder Pflicht-Kodex?
Während deutsche Sozialarbeiter*innen in Sachen Berufsethik auf Freiwilligkeit setzen, geht man auf den britischen Inseln den Weg der Verbindlichkeit – mit spannenden Konsequenzen. In Deutschland bleibt die Anerkennung berufsethischer Standards optional über das unverbindliche Berufsregister, während im Vereinigten Königreich alle Fachkräfte verpflichtend registriert sein müssen und sich an einen praxisnahen "Code of Conduct" zu halten haben. Der entscheidende Unterschied? Statt einer umfangreichen, teils praxisfernen Berufsethik wie in Deutschland setzt man in Großbritannien auf einen knappen, verständlichen Verhaltenskodex – ein Modell, das auch der deutschen Sozialen Arbeit neue Impulse für eine breitere berufsethische Verankerung geben könnte, ohne sich in theoretischen Details zu verlieren.
Resilienz
Welche Relevanz haben das Resilienzmodell und die Resilienzförderung für die Eingliederungshilfe (EGH) nach dem SGB IX für Erwachsene mit (drohenden) körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderungen?
Resilienz - die Fähigkeit, Krisen zu meistern und als Chance für Entwicklung zu nutzen. Dieser Text untersucht, wie das Konzept der Resilienz die Arbeit in der Eingliederungshilfe bereichern kann. Von theoretischen Grundlagen bis zu praktischen Ansätzen wird beleuchtet, welches Potenzial Resilienzförderung für Menschen mit Behinderungen bietet.
Vielfalt
Wie kann eine diversitätsorientierte Soziale Arbeit in der Eingliederungshilfe gestaltet werden, um den komplexen Bedürfnissen von Klient*innen mit Migrationshintergrund und psychischen Erkrankungen gerecht zu werden?
Der Text bietet einen faszinierenden Einblick in die komplexen Herausforderungen der Diversity-orientierten Sozialen Arbeit am Beispiel eines jungen Mannes mit Migrationshintergrund und psychischer Erkrankung. Durch eine detaillierte Fallanalyse werden die vielschichtigen Aspekte von Kultur, Religion, Gender und Behinderung beleuchtet und deren Auswirkungen auf die sozialarbeiterische Praxis kritisch reflektiert. Der Autor plädiert für einen bewussteren Umgang mit Diversity-Themen in der Eingliederungshilfe und regt dazu an, Religion als stabilisierende Ressource für Klient*innen zu verstehen und zu nutzen.
Bezugsbetreuung
Sollen wir Klient*innen ihre Bezugsbetreuer*innen jetzt auch noch selbst auswählen lassen?
Zwischen Selbstbestimmung und fachlicher Expertise gilt es, bei der Auswahl von Bezugsbetreuer*innen die richtige Balance zu finden. Dieser Text beleuchtet anhand konkreter Fallbeispiele, wie ein ausgewogener Ansatz in der Praxis aussehen kann.
Konflikte
Was tun bei länger andauernden Konflikten mit einer Klient*in?
Konflikte mit Klient*innen können in der Sozialen Arbeit zu großen Herausforderungen werden. Wie gehst du professionell damit um, wenn sich Spannungen aufbauen und die Zusammenarbeit schwierig wird? Unsere praxisnahen Handlungsempfehlungen zeigen dir, wie du dich und deine Klient*innen schützen kannst, ohne die Beziehung zu gefährden. Von Dokumentation und Selbstschutz über Teamarbeit und Supervision bis hin zu Deeskalationstechniken und Mediation - hier findest du bewährte Strategien, um Konflikte zu entschärfen und eine konstruktive Arbeitsgrundlage wiederherzustellen.
Positive Verhaltensunterstützung
Kann der Ansatz “Positive Verhaltensunterstützung” für die Arbeit mit Menschen mit seelischen Behinderungen und starken Verhaltensauffälligkeiten genutzt werden?
Die Positive Verhaltensunterstützung bietet einen vielversprechenden Ansatz für die Arbeit mit erwachsenen Menschen mit seelischen Behinderungen oder chronisch psychischen Erkrankungen.
Dieser ganzheitliche und ressourcenorientierte Ansatz, der ursprünglich für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt wurde, lässt sich gut auf diese Zielgruppe übertragen. Er fokussiert nicht nur auf die Reduzierung von Symptomen, sondern zielt darauf ab, die Lebensqualität und Autonomie der Betroffenen zu verbessern.
Die Positive Verhaltensunterstützung eröffnet neue Perspektiven für eine wertschätzende und effektive Begleitung von Menschen mit komplexen psychischen Herausforderungen.
Foto: Helena Lopes / Unsplash
Antisemitismus
Wie erkenne ich Antisemitismus und was kann ich tun?
Am 9. November 2024 gedenken wir der Reichspogromnacht von 1938 - ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte, das uns mahnt, wachsam zu bleiben und aktiv gegen Antisemitismus einzutreten. Als Sozialarbeiter*innen tragen wir eine besondere Verantwortung, Vorurteile zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Einführung in die IHRA-Definition von Antisemitismus, liefert praktische Beispiele zur Identifikation antisemitischer Äußerungen und Handlungen und zeigt Wege auf, wie wir angemessen darauf reagieren können. Nutzen wir diese Informationen, um unsere Arbeit zu verbessern und gemeinsam eine offene und inklusive Gesellschaft zu gestalten.
Foto: David Holifield / Unsplash
Auf Augenhöhe
Wie funktionieren Entscheidungen “auf Augenhöhe”?
Das Konzept "Auf Augenhöhe" basiert auf der Konsent-Entscheidungsfindung. Es erkennt Klient*innen als Expert*innen ihres Lebens an. Durch partizipative Entscheidungsprozesse fördert es eine gleichberechtigte Zusammenarbeit - ein spannender Ansatz, der traditionelle Rollenverteilungen hinterfragt und neue Perspektiven für die sozialarbeiterische Praxis eröffnet.
Foto: Soroush Karimi / Unsplash
Kommunikation
Wie kann ich die “Sprache der Giraffen” lernen?
Wie können wir respektvoll und wertschätzend miteinander kommunizieren, auch in Konfliktsituationen? Wie können wir unsere Bedürfnisse ausdrücken und dabei die Grenzen unseres Gegenübers achten? Marshall Rosenberg entwickelte mit der "Sprache der Giraffen" aka "Gewaltfreie Kommunikation" einen vielversprechenden Ansatz, der auch für die Soziale Arbeit von Interesse ist. In diesem Artikel erfährst Du, warum die "Sprache der Giraffen" so heißt und was so cool an ihr ist...
Hinweise
Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen und Antworten dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Orientierung. Sie stellen keine rechtsverbindliche Beratung oder verbindlichen Rechtsrat dar.
Unsere Beiträge ersetzen keine individuelle rechtliche oder sozialarbeiterische Beratung. Für eine auf Deinen Einzelfall zugeschnittene Beratung empfehlen wir Dir, Dich an qualifizierte Rechtsanwälte oder Sozialarbeiter zu wenden.
Die Informationen auf dieser Webseite wurden sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der bereitgestellten Inhalte übernehmen.
Bitte beachte, dass sich rechtliche Rahmenbedingungen und soziale Unterstützungsangebote ändern können. Wir bemühen uns, die Inhalte regelmäßig zu aktualisieren, können aber keine Garantie für deren fortwährende Gültigkeit geben.
Für weiterführende Informationen und eine persönliche Beratung wende Dich bitte an die zuständigen Behörden, Beratungsstellen oder andere Facheinrichtungen in Deiner Nähe.
Die Illustrationen wurden übrigens, soweit nicht anders erwähnt, von konsent.berlin mit Fotor und DALL·E erstellt.