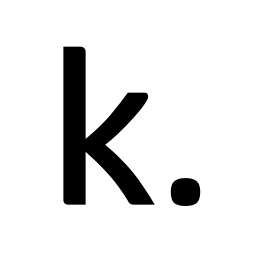Antisemitismus
Wie können Sozialarbeiterinnen auf Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Jüdinnen*Juden reagieren?
Am 9. November gedenken wir der Reichspogromnacht von 1938 - einem der dunkelsten Kapitel in der deutschen Geschichte. In dieser Nacht entfesselte das nationalsozialistische Regime eine Welle der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung, die den Beginn der systematischen Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden markierte. Synagogen wurden in Brand gesetzt, jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört, und unzählige Menschen wurden verhaftet, misshandelt oder ermordet. Die Geschehnisse dieser Nacht waren von beispielloser Brutalität geprägt.
Im Arbeitsalltag begegnen wir immer wieder Situationen, die eine besondere Sensibilität für die Themen Antisemitismus und Diskriminierung erfordern, von antisemitischen Vorurteilen bis hin zu Übergriffen gegen die wenigen Jüdinnen und Juden, die wir betreuen und die mit uns im Team arbeiten. Häufig werden wir mit subtilen Formen des Antisemitismus konfrontiert, die schwer erkennbar sind. Ein Beispiel dafür ist die Verwendung von Stereotypen oder Verschwörungstheorien über jüdische Menschen. Hier ist es wichtig, behutsam, aber bestimmt zu intervenieren und Aufklärungsarbeit zu leisten.
Es ist unsere Aufgabe, wachsam zu bleiben und aktiv gegen jede Form von Ausgrenzung und Intoleranz einzutreten. Wir können einen wichtigen Beitrag leisten, indem wir eine Atmosphäre des Respekts und der Offenheit schaffen: Die Bekämpfung von Antisemitismus erfordert ein kontinuierliches Engagement und die Bereitschaft, auch unbequeme Gespräche zu führen. Indem wir uns aktiv mit diesen Themen auseinandersetzen und unsere Handlungskompetenzen erweitern, tragen wir dazu bei, eine Gesellschaft zu gestalten, die auf den Grundsätzen der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Respekts aufbaut. Nur so können wir der Verantwortung gerecht werden, die uns aus den dunklen Kapiteln der deutschen Geschichte erwächst.
So ist es wichtig, dass wir uns mit der Frage auseinandersetzen: Wie erkennen wir Antisemitismus und was können wir dagegen tun? Der folgende Text bietet eine umfassende Einführung in die IHRA-Definition von Antisemitismus und liefert Beispiele, die uns helfen, antisemitische Äußerungen und Handlungen zu identifizieren und angemessen darauf zu reagieren.
IHRA-Definition
Die Frage, was denn als antisemtisch zu bewerten ist, löst häufig Unsicherheiten aus. Manche sorgen sich, dass bereits die Verwendung des Begriffs “Jude” als antisemitisch verstanden werden könnte. Sie weichen auf Umschreibungen wie “Menschen mosaischen Glaubens” oder “jüdische Mitbürger*innen” aus.
In der Bewertung von antisemtischen Vorfällen spielt die Defition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) eine wichtige Rolle. Die IHRA ist ein internationales Gremium, das sich der Erinnerung an den Holocaust und der Bekämpfung von Antisemitismus widmet. Ihre Arbeit ist auch für Sozialarbeiter*innen relevant, da sie Impulse für einen sensiblen und reflektierten Umgang mit Geschichte und Diskriminierung gibt. Derzeit gehören der IHRA 35 Mitgliedsländer und 9 Beobachterländer an. Diese beachtliche Zahl zeigt, wie wichtig das Thema international eingeschätzt wird. Die Mitgliedsländer arbeiten gemeinsam daran, Holocaust-bezogene Themen zu adressieren und Antisemitismus zu bekämpfen.
Die IHRA hat sich der Herausforderung angenommen und eine Arbeitsdefinition von Antisemitismus entwickelt. Diese entstand aus dem Bedürfnis heraus, eine international anerkannte Richtlinie zu schaffen, die als praktisches Werkzeug zur Einschätzung von antisemitischen Vorfällen dienen kann.
Link zur IHRA-Definition:
https://holocaustremembrance.com/resources/arbeitsdefinition-antisemitismus
Der Weg zu dieser Definition war lang: Bereits 2005 veröffentlichte das Europäische Zentrum zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit (EUMC) einen ersten Entwurf. Die IHRA griff diesen auf. Am 26. Mai 2016 wurde die Arbeitsdefinition schließlich offiziell von der IHRA-Plenarsitzung in Bukarest angenommen (IHRA, 2016). Es ist wichtig zu betonen, dass diese Definition nicht rechtsverbindlich ist. Vielmehr soll sie als praktisches Instrument dienen, um Antisemitismus zu erkennen und zu bekämpfen.
Ein zentraler Kritikpunkt an der IHRA-Definition ist die Befürchtung, dass sie die Meinungsfreiheit und legitime Kritik an der israelischen Politik einschränken könnte. Kritiker äußern, dass “ die Definition [...] so vage [ist], dass sie fast jede Kritik an Israel als antisemitisch einstufen könnte" (Stern, 2019). Dies führt zu Bedenken hinsichtlich der Anwendbarkeit in der Praxis. Alternativen wie die Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) versuchen, eine präzisere Definition zu bieten, die zwischen Antisemitismus und Israelkritik differenziert (Feldman, 2021). Die JDA hingegen wird von vielen jedoch als zu nachsichtig gegenüber bestimmten Formen des israelbezogenen Antisemitismus angesehen. Es wird bemängelt, dass sie „möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt, wie antizionistische Rhetorik in antisemitische Narrative übergehen kann" (Lipstadt, 2022).
Die IHRA-Definition scheint mir, eine hilfreiche und zielführende Arbeitsdefinition auch für die Soziale Arbeit zu sein, zumal sie von der Bundesregierung und Fachstellen wie dem anerkannten Recherche und Informationszentrum für Antisemitismus (RIAS). Sie bietet einen umfassenden Rahmen für das Verständnis und die Erkennung antisemitischer Äußerungen und Handlungen in der heutigen Zeit.
Antisemitismus beschreibt die IHRA-Definition als "eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann" und betont, dass sich dieser sowohl gegen Einzelpersonen als auch gegen jüdische Institutionen oder den Staat Israel richten kann. Die Definition hebt hervor, dass Antisemitismus oft mit Verschwörungstheorien und negativen Stereotypen einhergeht und sich in verschiedenen Formen manifestieren kann. Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen legitimer Kritik an Israel und antisemitischen Äußerungen, wobei die Definition betont, dass "Kritik an Israel, die mit der an anderen Ländern vergleichbar ist, nicht als antisemitisch betrachtet werden" kann (IHRA, 2016).
IHRA-Beispiele
Die IHRA hat der Antisemitismus-Definition eine Liste von Beispielen angehängt, die uns als praxisnahe Orientierung dienen kann. Diese Beispiele umfassen ein breites Spektrum antisemitischer Verhaltensweisen - von offenen Gewaltaufrufen über subtilere Formen wie die Holocaustleugnung bis hin zur Anwendung doppelter Standards gegenüber Israel. Sie bieten eine wertvolle Hilfestellung, um Antisemitismus im Arbeitsalltag zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren.
Im Folgenden werden wir uns eingehend mit diesen Beispielen befassen, sie im Wortlaut der IHRA (2016) lesen und sie in den Kontext aktueller Fälle sowie historischer Ereignisse einordnen. Ziel ist es, unser Verständnis für die vielfältigen Ausprägungen des Antisemitismus zu vertiefen und uns besser darauf vorzubereiten, antisemitische Tendenzen zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken.
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass wir in unserer Arbeit oft mit Menschen zu tun haben, die aufgrund ihrer Lebenssituation besonders empfänglich für vereinfachende Welterklärungen oder Verschwörungstheorien sein können. Wir können für unsere Klient*innen einen Raum schaffen, in dem sie differenzierte Sichtweisen entwickeln können. In diesem Sinne können wir die IHRA-Beispiele als Werkzeug nutzen, um sensibel und reflektiert mit dem Thema Antisemitismus umzugehen und gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse und Hintergründe unserer Klient*innen zu berücksichtigen.
“Der Aufruf zur Tötung oder Schädigung von Jüdinnen und Juden im Namen einer radikalen Ideologie oder einer extremistischen Religionsanschauung sowie die Beihilfe zu solchen Taten oder ihre Rechtfertigung.”
Ein besonders erschütterndes Beispiel ist der rechtsextreme Terroranschlag in Halle (Saale) am 9. Oktober 2019. An jenem Tag versuchte ein schwer bewaffneter Attentäter, in eine Synagoge einzudringen, in der gerade der Jom-Kippur-Gottesdienst stattfand. Obwohl er glücklicherweise nicht in das Gebäude gelangen konnte, endete sein Amoklauf tragisch mit zwei Todesopfern - einer Passantin und einem Mann in einem nahegelegenen Döner-Imbiss.
Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass der Täter seine Tat live im Internet übertrug und dabei offen antisemitische und rassistische Parolen äußerte. Dies zeigt deutlich, wie tief verwurzelt seine extremistische Ideologie war, die von Hass auf Juden und andere Minderheiten geprägt war.
Als Fachkräfte in der sozialen Arbeit stehen wir vor der Herausforderung, solche radikalen Ansichten frühzeitig zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken. Dabei geht es nicht nur um die Sicherheit einzelner Gruppen, sondern um den Schutz des sozialen Friedens in unserer gesamten Gesellschaft.
“Falsche, entmenschlichende, dämonisierende oder stereotype Anschuldigungen gegen Jüdinnen und Juden oder die Macht der Jüdinnen und Juden als Kollektiv – insbesondere aber nicht ausschließlich die Mythen über eine jüdische Weltverschwörung oder über die Kontrolle der Medien, Wirtschaft, Regierung oder anderer gesellschaftlicher Institutionen durch die Jüdinnen und Juden.”
Ein zentrales Element antisemitischer Rhetorik ist die Vorstellung einer "jüdischen Weltverschwörung". Dieser Mythos unterstellt Jüdinnen und Juden eine kollektive, geheime Kontrolle über globale Ereignisse und Institutionen. Solche Anschuldigungen sind nicht nur falsch, sondern auch zutiefst entmenschlichend. Sie reduzieren eine vielfältige Gruppe von Menschen auf ein homogenes, bedrohliches "Anderes". Besonders problematisch sind Behauptungen über eine angebliche jüdische Kontrolle der Medien, Wirtschaft oder Regierungen. Diese Vorstellungen ignorieren die Komplexität moderner Gesellschaften und projizieren stattdessen simplifizierende Erklärungsmuster auf eine Minderheit. Wie Salzborn betont: "Antisemitische Verschwörungstheorien dienen dazu, komplexe gesellschaftliche Zusammenhänge auf ein vermeintlich einfaches Ursache-Wirkungs-Prinzip zu reduzieren" (Salzborn, 2020). Ein weiteres häufig auftretendes Stereotyp ist das des "geldgierigen Juden". Diese Zuschreibung hat eine lange, düstere Geschichte und wurde oft benutzt, um wirtschaftliche Diskriminierung und Verfolgung zu rechtfertigen. Es ist wichtig zu verstehen, dass solche Vorurteile nicht auf Fakten basieren, sondern auf jahrhundertealten Mythen und Fehlinformationen.
In unserer Arbeit mit Klient*innen ist es essenziell, sensibel für solche Denkmuster zu sein und sie kritisch zu hinterfragen. Wie Zick et al. (2017) in ihrer Studie zeigen, sind antisemitische Einstellungen oft mit anderen Formen von Diskriminierung und Ausgrenzung verwoben: "Antisemitismus korreliert signifikant mit anderen Vorurteilsstrukturen wie Rassismus, Islamfeindlichkeit und Sexismus". Es liegt in unserer Verantwortung, diese schädlichen Klischees zu erkennen und aktiv dagegen vorzugehen. Dies kann durch Bildungsarbeit, offene Gespräche und die Förderung interkultureller Begegnungen geschehen. Dabei ist es wichtig, die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland sichtbar zu machen und Stereotype durch differenzierte Darstellungen zu ersetzen. Letztendlich geht es darum, eine Gesellschaft zu fördern, die auf gegenseitigem Respekt und Verständnis basiert. Als Fachkräfte haben wir die Möglichkeit, einen wichtigen Beitrag zu diesem Prozess zu leisten, indem wir antisemitische Denkmuster hinterfragen und unseren Klient*innen alternative Perspektiven aufzeigen.
“Das Verantwortlichmachen der Jüdinnen und Juden als Volk für tatsächliches oder unterstelltes Fehlverhalten einzelner Jüdinnen und Juden, einzelner jüdischer Gruppen oder sogar von Nichtjüdinnen und Nichtjuden.”
Ein besonders prägnanter Fall ist die Dreyfus-Affäre im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts. Hier wurde ein einzelner jüdischer Offizier fälschlicherweise des Hochverrats bezichtigt, was eine Welle des Antisemitismus auslöste. Dieses Ereignis zeigt eindrücklich, wie schnell individuelle Anschuldigungen zu einer Verurteilung einer ganzen Gruppe führen können. Auch in jüngerer Vergangenheit lassen sich solche Muster erkennen. Während der Finanzkrise 2008 wurden beispielsweise jüdische Banker pauschal als Sündenböcke dargestellt, obwohl die Ursachen der Krise weitaus komplexer waren. Solche Zuschreibungen ignorieren die Vielschichtigkeit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse und bedienen stattdessen antisemitische Stereotype. Besonders hartnäckig hält sich die Verschwörungstheorie einer angeblichen jüdischen Kontrolle über die Medien. Diese Behauptung schürt antisemitische Ressentiments und verkennt die Vielfalt und Unabhängigkeit moderner Medienlandschaften. "Das Verantwortlichmachen der Jüdinnen und Juden als Volk für tatsächliches oder unterstelltes Fehlverhalten einzelner Jüdinnen und Juden, einzelner jüdischer Gruppen oder sogar von Nichtjüdinnen und Nichtjuden" (Bundesverband RIAS, 2023) ist ein Kernmerkmal des Antisemitismus und muss als solches erkannt und bekämpft werden.
In unserem beruflichen Kontext ist es essenziell, solche Dynamiken zu verstehen und ihnen aktiv entgegenzuwirken. Wir sind gefordert, Vorurteile zu erkennen, sie zu hinterfragen und uns für eine offene, tolerante Gesellschaft einzusetzen. Dies bedeutet auch, unsere Klient*innen für diese Themen zu sensibilisieren und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie selbst zu einem respektvollen Miteinander beitragen können.
“Das Bestreiten der Tatsache, des Ausmaßes, der Mechanismen (z.B. der Gaskammern) oder der Vorsätzlichkeit des Völkermordes an den Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland und seine Unterstützer und Komplizen während des Zweiten Weltkrieges (Holocaust).”
Ein besonders sensibles ist die Leugnung des Holocausts. Es ist wichtig, dass wir als Fachkräfte in der Lage sind, solchen Äußerungen kompetent und sachlich zu begegnen. Holocaust-Leugnung ist vielschichtig. Es handelt sich nicht nur um die komplette Leugnung, sondern auch um die Verharmlosung oder Verdrehung historischer Tatsachen. Ein prominentes Beispiel für Holocaust-Leugnung in Deutschland ist der Fall von Ursula Haverbeck. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters hat sie wiederholt öffentlich behauptet, dass Auschwitz kein Vernichtungslager, sondern lediglich ein Arbeitslager gewesen sei. Sie bestritt die Existenz von Gaskammern und die systematische Ermordung von Juden während des Nationalsozialismus. Diese Äußerungen führten zu mehrfachen strafrechtlichen Verfolgungen und Verurteilungen, einschließlich Haftstrafen. Der Fall Haverbeck zeigt exemplarisch, wie wichtig es ist, gegen solche Falschdarstellungen vorzugehen und die historischen Fakten zu bewahren. Als Fachkräfte in der sozialen Arbeit haben wir eine besondere Verantwortung, durch Bildung und Aufklärung die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten und Leugnungen entgegenzutreten.
Es ist wichtig zu betonen, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust-Leugnung nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine moralische und gesellschaftliche Dimension hat. In diesem Sinne sollten wir in unserer Arbeit stets einen Ansatz verfolgen, der Verständnis und Bildung in den Vordergrund stellt, ohne dabei die Würde und die individuellen Herausforderungen unserer Klient*innen aus den Augen zu verlieren. In unserer Praxis können wir auf verschiedene Weise dazu beitragen: Zum einen können wir wir kritisches Denken fördern, indem wir sie ermutigen, Informationen zu hinterfragen und verlässliche Quellen zu erkennen. Zum anderen können wir historische Bildung in unsere Arbeit bringen, um das Verständnis für die Ereignisse des Holocausts zu vertiefen. Schließlich können wir Methoden nutzen, die Empathie und Perspektivwechsel ermöglichen, sodass unsere Klientinnen die Tragweite des Geschehenen besser nachempfinden können. Durch diese ganzheitliche Herangehensweise tragen wir dazu bei, ein reflektiertes und respektvolles Bewusstsein für dieses wichtige Thema zu schaffen.
“Der Vorwurf gegenüber den Jüdinnen und Juden als Volk oder dem Staat Israel, den Holocaust zu erfinden oder übertrieben darzustellen.”
Ein prägnantes Beispiel für diesen Vorwurf lieferte der ehemalige iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Seine öffentlichen Stellungnahmen, in denen er den Holocaust als "Mythos" und "Lüge" bezeichnete, sind nicht nur historisch falsch, sondern auch zutiefst verletzend für Überlebende und ihre Nachkommen. Besonders alarmierend war seine Forderung im Jahr 2005, "Israel von der Landkarte zu tilgen", sowie die Ausrichtung einer sogenannten "Holocaust-Konferenz" 2006 in Teheran, zu der Holocaust-Leugner aus aller Welt eingeladen wurden.
Solche Äußerungen sind nicht nur ein Angriff auf historische Tatsachen, sondern fördern auch antisemitische Ressentiments. Sie stellen eine besondere Herausforderung für unsere Arbeit dar, da sie das Potenzial haben, Vorurteile zu schüren und den sozialen Zusammenhalt zu gefährden. Es ist daher von großer Bedeutung, dass wir als Fachkräfte solche Narrative erkennen und ihnen aktiv entgegentreten. Es ist unsere Aufgabe, einen Raum zu schaffen, in dem offene Gespräche über Geschichte und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart möglich sind. Dabei sollten wir sensibel auf die individuellen Erfahrungen und Perspektiven unserer Klient*innen eingehen und gleichzeitig klare Grenzen setzen, wenn es um die Verbreitung von Falschinformationen oder antisemitischen Äußerungen geht.
“Der Vorwurf gegenüber Jüdinnen und Juden, sie fühlten sich dem Staat Israel oder angeblich bestehenden weltweiten jüdischen Interessen stärker verpflichtet als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer.”
Ein besonders problematischer Vorwurf ist der Vorwurf der "doppelten Loyalität", der oft gegenüber jüdischen Mitbürger*innen erhoben wird. Er basiert auf der unbegründeten Annahme, dass Jüdinnen und Juden dem Staat Israel oder vermeintlichen weltweiten jüdischen Interessen stärker verbunden seien als den Belangen ihrer jeweiligen Heimatländer. Diese Unterstellung ist nicht nur falsch, sondern auch gefährlich, da sie antisemitische Stereotype bedient und das Vertrauen in die Integrität jüdischer Mitbürger*innen untergräbt. Ein prägnanter Vorfall ereignete sich 2019 in den USA. Die Kongressabgeordnete Ilhan Omar löste eine kontroverse Debatte aus, als sie in einer öffentlichen Äußerung die politische Unterstützung für Israel kritisierte und dabei implizierte, dass jüdische Amerikaner eher Israel als den Vereinigten Staaten loyal seien (Stolberg, 2019). Diese Aussage wurde weithin als antisemitisch wahrgenommen, da sie das altbekannte Stereotyp der "doppelten Loyalität" bediente.
“Das Aberkennen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, z.B. durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.”
In der komplexen Welt der internationalen Beziehungen und Menschenrechte stoßen wir immer wieder auf Kontroversen, die uns herausfordern. Ein besonders sensibles Thema, das in den letzten Jahren für erhebliche Diskussionen sorgte, betrifft die Bewertung der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Im Jahr 2021 veröffentlichte Human Rights Watch (HRW) einen Bericht, dem 2022 eine ähnliche Publikation von Amnesty International folgte. Beide Organisationen kamen zu dem brisanten Schluss, Israel betreibe eine Apartheidpolitik gegenüber den Palästinensern. Diese Einschätzung löste erwartungsgemäß heftige Reaktionen aus. Die israelische Regierung und viele ihrer Unterstützer interpretierten diese Berichte als Angriff auf die Legitimität des Staates Israel und als Versuch, dem jüdischen Volk das Recht auf Selbstbestimmung abzusprechen. Sie argumentieren, dass solche Darstellungen implizit die Existenz Israels als "rassistisches Unterfangen" brandmarken würden. Die Reaktionen auf diese Berichte zeigen deutlich, wie polarisierend solche Themen wirken können. Während einige Menschenrechtsorganisationen und Regierungen die Schlussfolgerungen der Berichte unterstützten und Maßnahmen gegen Israel forderten, verurteilten andere, darunter prominente jüdische Organisationen und einige westliche Regierungen, die Berichte als einseitig und unfair.
Es ist wichtig, diese Kontroverse differenziert zu betrachten und die Realität der israelischen Gesellschaft zu berücksichtigen. Israel ist eine vielfältige Demokratie, in der Menschen verschiedener Ethnien und Religionen gleichberechtigt leben und arbeiten. Ein bemerkenswertes Beispiel hierfür ist die Präsenz muslimischer Richter am Obersten Gerichtshof Israels, wie etwa Richter Khaled Kabub, der 2022 ernannt wurde (Boxerman, 2022). Zudem studieren arabische Israelis an renommierten Universitäten des Landes und sind in allen Bereichen der Gesellschaft vertreten, einschließlich des Gesundheitswesens, der Wirtschaft und der Politik. Diese Tatsachen widersprechen der Behauptung, Israel sei ein "rassistisches Unterfangen". Vielmehr zeigen sie, dass Israel, trotz der zweifellos vorhandenen Herausforderungen und Konflikte, eine pluralistische Gesellschaft ist, die sich um Gleichberechtigung und Integration bemüht. Als Fachkräfte sollten wir solche komplexen Themen stets kritisch und differenziert betrachten, um ein ausgewogenes Verständnis zu fördern und Vorurteile abzubauen.
“Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet oder gefordert wird.”
Betrachten wir die Situation Israels im internationalen Kontext: Hier zeigt sich eine auffällige Diskrepanz in der Beurteilung und den Erwartungen, die an diesen Staat im Vergleich zu anderen Nationen gestellt werden. Diese ungleiche Behandlung manifestiert sich in verschiedenen Bereichen: Zunächst fällt auf, dass Israel im UN-Menschenrechtsrat überproportional häufig kritisiert wird, während gravierende Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit erhalten. Ein weiterer Aspekt ist die nahezu unmögliche Erwartung einer fehlerfreien Vorgehensweise Israels in militärischen Auseinandersetzungen, insbesondere hinsichtlich ziviler Opfer. Diese Maßstäbe werden an andere demokratische Staaten in ähnlichen Konfliktsituationen nicht angelegt. Schließlich wird Israels Siedlungspolitik stark kritisiert, während andere Staaten mit vergleichbaren territorialen Konflikten weniger in die Verantwortung genommen werden. Diese unterschiedliche Behandlung verdeutlicht, wie Israel häufig nach Maßstäben beurteilt wird, die für andere demokratische Staaten nicht gelten.
“Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen (z.B. der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende), um Israel oder die Israelis zu beschreiben.”
In den letzten Jahren lässt sich beobachten, dass traditionelle antisemitische Bilder und Symbole zunehmend verwendet werden, um den Staat Israel oder israelische Bürger*innen zu diffamieren. Dies ist nicht nur verletzend für die Betroffenen, sondern fördert auch die Verbreitung antisemitischer Vorurteile in der Gesellschaft. Ein Beispiel für diese problematische Vermischung war eine Karikatur, die 2021 in der "New York Times" erschien. Sie zeigte den damaligen israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu mit einer Davidstern-Armbinde - ein Bild, das unweigerlich Assoziationen zu antisemitischen Stereotypen weckt. Auch bei Demonstrationen, die sich vordergründig gegen die israelische Politik richten, tauchen immer wieder antisemitische Symbole auf. So wurden bei einer Demonstration in Berlin im Jahr 2023 Plakate gezeigt, die Israel mit Nazi-Deutschland gleichsetzten und antisemitische Symbole wie Davidsterne mit Hakenkreuzen kombinierten. Solche Vergleiche sind nicht nur historisch falsch, sondern verhöhnen auch die Opfer des Holocaust. Besonders problematisch ist die Verbreitung antisemitischer Inhalte in sozialen Medien. Hier kursieren Memes und Bilder, die israelische Soldaten als blutrünstige Monster darstellen und damit auf mittelalterliche Ritualmordlegenden anspielen. Diese Darstellungen bedienen uralte antisemitische Stereotype und tragen zu deren Verfestigung bei.
Als Fachkräfte in der sozialen Arbeit sind wir gefordert, solche Fälle von Antisemitismus zu erkennen und aktiv dagegen vorzugehen. Dabei geht es nicht darum, legitime Kritik an der israelischen Politik zu unterbinden, sondern antisemitische Stereotype und Argumentationsmuster zu entlarven.
“Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten.”
Ein Beispiel für die Brisanz solcher Vergleiche zeigte sich bei der Documenta 15 im Jahr 2022. Hier wurden Kunstwerke präsentiert, die Israel mit dem Nationalsozialismus gleichsetzten, was zu heftiger Kritik führte. Derartige Gleichsetzungen stoßen auf Kritik, da sie als historisch unzutreffend und verletzend empfunden werden. Sie bergen die Gefahr, die singuläre Bedeutung der Shoah zu schmälern und können zudem zur Verfestigung judenfeindlicher Vorurteile beitragen. Auch im politischen Kontext können solche Vergleiche zu internationalen Spannungen führen. So lösten die Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva im Jahr 2023 eine Kontroverse aus, als er die israelische Politik gegenüber den Palästinensern mit der Nazi-Politik verglich (Williams & Ayres (2024).
In unserer täglichen Arbeit ist es wichtig, dass wir solche Themen mit der nötigen Sensibilität und fachlichen Kompetenz angehen. Wir sollten in der Lage sein, unseren Klient*innen zu vermitteln, warum solche Vergleiche problematisch sind, ohne dabei belehrend oder bevormundend zu wirken. Es geht darum, einen Raum für differenzierte Diskussionen zu schaffen, in dem auch schwierige Themen angesprochen werden können, ohne dabei in vereinfachende oder verletzende Rhetorik zu verfallen. Dabei können wir unsere Klient*innen darin unterstützen, ihre Gedanken und Gefühle auf eine Weise auszudrücken, die respektvoll und konstruktiv ist.
“Das kollektive Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für Handlungen des Staates Israel.”
Die Ereignisse der letzten Jahre haben ein besorgniserregendes Phänomen in den Fokus gerückt: die kollektive Verantwortlichmachung von Jüdinnen und Juden für Handlungen des Staates Israel. Dieses Muster zeigt sich in verschiedenen Ausprägungen und stellt uns als Fachkräfte vor komplexe Herausforderungen. Besonders deutlich wurde diese Problematik während des Gaza-Konflikts 2021 und seit dem 7. Oktober 2023. Weltweit kam es zu einem sprunghaften Anstieg antisemitischer Vorfälle. Jüdische Gemeinschaften sahen sich plötzlich mit Angriffen konfrontiert, die weit über jede Form legitimer politischer Kritik hinausgingen. Bei Demonstrationen, die vordergründig gegen die israelische Politik gerichtet waren, wurden antisemitische Parolen laut, die das Existenzrecht Israels in Frage stellten und jüdische Menschen pauschal diffamierten. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass sich diese Feindseligkeit auch gegen jüdische Unternehmen und Einrichtungen richtete, die keinerlei Verbindung zur israelischen Regierung haben. Boykottaufrufe und gezielte Anfeindungen trafen Menschen allein aufgrund ihrer Zugehörigkeit zum Judentum. Diese Vorfälle "tragen zur Verbreitung von Antisemitismus bei und gefährden die Sicherheit jüdischer Gemeinschaften" (Zick et al., 2017).
In unserer täglichen Arbeit begegnen wir den Auswirkungen dieser Entwicklung auf vielfältige Weise. Wir sehen uns mit Ängsten und Verunsicherungen konfrontiert, die weit über den aktuellen politischen Kontext hinausreichen. Es ist unsere Aufgabe, sensibel auf diese Sorgen zu reagieren und gleichzeitig klare Grenzen zu ziehen, wenn es um antisemitische Äußerungen oder Handlungen geht. Dabei ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen: "Antisemitismus ist keine Meinung, sondern eine Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit" (Salzborn, 2020). Diese Erkenntnis sollte unser professionelles Handeln leiten und uns ermutigen, aktiv gegen jede Form der Diskriminierung einzutreten. Wie können wir in unserem Arbeitsalltag dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und ein Klima des gegenseitigen Respekts zu fördern? Wie gelingt es uns, die komplexen Zusammenhänge des Nahost-Konflikts zu vermitteln, ohne dabei Stereotype zu bedienen oder einseitige Schuldzuweisungen vorzunehmen? Diese Fragen sollten uns als Fachkräfte beschäftigen und zu einem kontinuierlichen Reflexionsprozess anregen.
3-Stufen-Modell zum Umgang mit Antisemitismus
In der täglichen Arbeit mit Menschen, die aufgrund ihrer seelischen Verfassung besondere Unterstützung benötigen, stellt der Umgang mit antisemitischen Äußerungen oder Verhaltensweisen eine besondere Herausforderung dar. Um in solchen Fällen professionell und effektiv zu reagieren, schlage ich ein dreistufiges Interventionsmodell vor. In diesem Modell ist es entscheidend, dass wir sowohl kurzfristig handlungsfähig sind als auch langfristige Strategien entwickeln. Nur so können wir ein Umfeld schaffen, in dem sich alle Menschen sicher und respektiert fühlen.
Stufe 1 - sofortige Reaktion: Schutz und unmittelbares Feedback
In der akuten Situation steht der Schutz potenzieller Opfer an oberster Stelle. Gleichzeitig ist es wichtig, dem Verursacher oder der Verursacherin ein unmittelbares Feedback zu geben. Dies kann in Form einer klaren Grenzziehung geschehen, indem wir deutlich machen, dass antisemitische Äußerungen oder Handlungen nicht toleriert werden. Dabei sollten wir bedenken, dass "eine Intervention in der Situation [...] immer auch eine Botschaft an die Umstehenden" ist (Chernivsky & Wiegemann, 2017).
Stufe 2 - zeitnahe Aufarbeitung: Klärungsgespräch und Opferbetreuung
Nach dem unmittelbaren Eingreifen ist es wichtig, zeitnah in den folgenden Tagen ein vertiefendes Klärungsgespräch zu führen. Hier bietet sich die Möglichkeit, die Situation differenzierter zu betrachten und dem Verursacher oder der Verursacherin ein ausführlicheres Feedback zu geben. Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, uns um die Betreuung und Unterstützung möglicher Opfer zu kümmern. "Die Betroffenenperspektive ernst zu nehmen bedeutet, die subjektive Wahrnehmung und Deutung der Betroffenen anzuerkennen" (Bernstein, 2020).
Stufe 3 - langfristige Strategie: Prävention und Bildungsarbeit
Um antisemitischen Vorfällen nachhaltig vorzubeugen, ist es unerlässlich, langfristige Präventionsmaßnahmen zu etablieren. Dies kann durch gezielte Bildungsarbeit und die Förderung interkultureller Kompetenzen geschehen. Dabei ist es wichtig, einen Ansatz zu wählen, der die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten unserer Klient*innen berücksichtigt. "Präventionsarbeit sollte [...] die Lebenswelten der Adressatinnen in den Blick nehmen und an deren Erfahrungen anknüpfen" (Salzborn & Kurth, 2019).
Ganzheitlicher Ansatz für nachhaltiges Konfliktmanagement
Das 3-Stufen-Modell erweist sich als umfassender Ansatz, der wesentliche Elemente bewährter Interventionsstrategien integriert. Es beginnt mit einer sofortigen Reaktion, die den Schutz der Opfer und die direkte Konfrontation der Täter in den Mittelpunkt stellt. Darauf folgt eine zeitnahe Aufarbeitung, die durch Klärungsgespräche und gezielte Unterstützung der Betroffenen gekennzeichnet ist. Schließlich mündet das Modell in eine langfristige Strategie, die auf Bildung und nachhaltige Präventionsarbeit setzt, um zukünftige Vorfälle zu verhindern. Dieser ganzheitliche Ansatz berücksichtigt sowohl die akuten Bedürfnisse in Krisensituationen als auch die Notwendigkeit langfristiger Veränderungen und bietet somit eine solide Grundlage für effektives Konfliktmanagement und Prävention.
Fallbeispiele
In der Praxis begegnen uns verschiedene Ausprägungen von Antisemitismus. Die nachfolgend geschilderten Fälle verdeutlichen die Bandbreite: Von direkten verbalen Attacken zwischen Betreuten bis hin zur bewussten Zurschaustellung rechtsextremer Symbolik durch einzelne Personen. Diese Situationen stellen die Fachkräfte vor die Aufgabe, angemessen auf diskriminierende Verhaltensweisen zu reagieren und ein Klima der gegenseitigen Achtung zu schaffen. Der Einsatz des 3-Stufen-Modells erweist sich hierbei als hilfreicher Leitfaden, um solche Vorkommnisse systematisch anzugehen und nachhaltig ein Umfeld zu gestalten, das von Sicherheit und Akzeptanz geprägt ist.
Fall 1: Antisemitische Beleidigung unter Betreuten/Besucher*innen
Zwei betreute Personen geraten im Gemeinschaftsraum in einen Streit. Einer der beiden, dessen Vater jüdisch ist, wird vom anderen mit der rassistischen Aussage „Geh zurück in den Ofen, Jude“ beleidigt. Der Betroffene zeigt keine offensichtlichen Anzeichen von Verärgerung. Ein Sozialarbeiter greift ein und spricht den Täter an, warum er diese Äußerung gemacht habe. Der Täter reagiert patzig und fragt: „Sind wir jetzt hier an der Ostküste, oder was?“ Zudem wirft er den Betreuer*innen vor: „Ihr gehorcht wohl auch der Weltregierung.“
Das konkrete Vorgehen anhand des 3-Stufen-Modells könnte so aussehen:
Stufe 1 – Sofortige Intervention: Schutz und unmittelbares Feedback
Unterbrechen und Ansprechen: Der Sozialarbeiter muss unverzüglich eingreifen, indem er den beleidigenden Kommentar direkt anspricht. Es ist essenziell, klarzustellen, dass solche diskriminierenden Aussagen inakzeptabel sind und den Richtlinien der Einrichtung widersprechen.
Schutz des Betroffenen: Auch wenn der betroffene Betreute keine sichtbare Reaktion zeigt, sollte der Sozialarbeiter sicherstellen, dass er sich geschützt und unterstützt fühlt. Dies beinhaltet gegebenenfalls eine räumliche Trennung der Konfliktparteien, um weitere Eskalationen zu verhindern.
Deutliche Grenzziehung: dem Täter wird klar kommuniziert, dass antisemitische Äußerungen nicht toleriert werden. Dies sendet eine prägnante Botschaft an alle Anwesenden, dass Diskriminierung keinen Platz in der Gemeinschaft hat.
Stufe 2 – Zeitnahe Aufarbeitung: Klärungsgespräch und Opferbetreuung
Klärungsgespräch: Innerhalb der nächsten Tage sollte ein vertiefendes Gespräch mit dem Täter geführt werden. Ziel ist es, die Hintergründe seines Verhaltens zu verstehen und ihm die Auswirkungen seiner Worte zu verdeutlichen.
Opferbetreuung: Dem betroffenen Betreuten sollte angeboten werden, über seine Gefühle und eventuelle Beeinträchtigungen zu sprechen. Es ist wichtig, seine Perspektive ernst zu nehmen und ihm Unterstützung anzubieten.
Dokumentation des Vorfalls: Der Vorfall sollte sorgfältig dokumentiert werden, um zukünftige Maßnahmen und Präventionsstrategien zu unterstützen.
Stufe 3 – Langfristige Strategie: Prävention und Bildungsarbeit
Bildungsarbeit: Regelmäßige Workshops und Schulungen sollten eingeführt werden, um das Bewusstsein für Antisemitismus und andere Formen von Diskriminierung zu schärfen. Experten können eingebunden werden, um fundiertes Wissen zu vermitteln.
Förderung von Empathie und Toleranz: Durch Gruppenangebote und interkulturelle Aktivitäten wird das Verständnis und die Empathie unter den Betreuten gestärkt. Dies trägt dazu bei, ein respektvolles Miteinander zu fördern.
Projekte zur Sensibilisierung: Langfristige Projekte, die sich mit Diskriminierung und deren Auswirkungen auseinandersetzen, sollten initiiert werden. Diese Projekte helfen, ein dauerhaftes Bewusstsein zu schaffen und Vorurteile abzubauen.
Unterstützungssysteme etablieren: Ein Netzwerk aus Unterstützungssystemen für Betroffene von Diskriminierung sollte aufgebaut werden. Zudem sollten regelmäßige Reflexionsmöglichkeiten für Fachkräfte und Betreute angeboten werden, um kontinuierlich an einem respektvollen Miteinander zu arbeiten.
Durch die Anwendung dieses 3-Stufen-Modells kann ein sicheres und respektvolles Umfeld geschaffen werden, in dem alle Betreuten sich geschützt und wertgeschätzt fühlen.
Fall 2: Betreuter zeichnet wiederholt antisemitische Symbole
Ein betreuter Klient in einer sozialen Einrichtung zeichnet wiederholt rote Dreiecke sowie den Code „88“ an die Wände der Einrichtung. Der Code steht für den Gruß „Heil Hitler“ und ist in rechtsextremen Kreisen gebräuchlich. Trotz mehrfacher Warnungen und Aufklärungsmaßnahmen über die Bedeutung dieser Symbole setzt der Klient sein Verhalten fort. Die anderen Bewohner*innen empfinden dieses Verhalten als amüsant und feiern den Klienten, da er den Betreuenden demonstriert, dass sie „uns nicht vorschreiben können, wie wir denken sollen“. Einige Fachkräfte unterstützen diese Haltung mit der Begründung, dass „Politik nicht unsere Aufgabe“ sei.
Das konkrete Vorgehen anhand des 3-Stufen-Modells könnte so aussehen, wobei aufgrund der Fallkonstellation Opferschutz und -betreuung entfallen:
Stufe 1 – Sofortige Intervention: unmittelbares Feedback
Klare Grenzen setzen: Der Klient wird nochmals unmissverständlich darauf hingewiesen, dass die Verwendung von rechtsextremen Symbolen und Codes in der Einrichtung nicht toleriert wird und gegen die Hausordnung verstößt.
Konsequenzen aufzeigen: Es werden die möglichen Konsequenzen seines Handelns erläutert, sowohl innerhalb der Einrichtung (z. B. Verwarnungen, zeitweilige Isolation) als auch gesellschaftlich (z. B. strafrechtliche Konsequenzen bei der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen).
Stufe 2 – Zeitnahe Aufarbeitung: Klärungsgespräch
Einzelgespräch: Durchführung eines persönlichen Gesprächs mit dem Klienten, um die Beweggründe für sein Verhalten zu verstehen. Dabei wird versucht, Hintergründe wie Frustration, Identitätsfragen oder Beeinflussung durch äußere Einflüsse zu ergründen.
Stufe 3 – Langfristige Strategie: Prävention und Bildungsarbeit
Aufklärung: Nutzung des Vorfalls als Anlass für weiterführende Aufklärungsarbeit innerhalb der Einrichtung:
Filme und Dokumentationen zur Geschichte des Nationalsozialismus und den Folgen des Antisemitismus.
Diskussionen und Workshops, in denen die Bedeutung und die Auswirkungen rechtsextremer Symbole thematisiert werden.
Besuche in Gedenkstätten, Museen oder Synagogen, um ein tieferes Verständnis und Empathie zu fördern.
Präventionsprogramme: Implementierung von langfristigen Präventionsprogrammen gegen Extremismus und Antisemitismus. Diese Programme sollten regelmäßig aktualisiert und an die spezifischen Bedürfnisse der betreuten Personen angepasst werden. Inhalte können beinhalten:
Schulungen zu demokratischen Werten und Menschenrechten.
Förderung von kritischem Denken und Medienkompetenz.
Unterstützung bei der Entwicklung eines positiven Selbstbildes und sozialer Kompetenzen.
Einrichtungsklima verbessern: Förderung eines respektvollen, toleranten und vielfältigen Umfelds innerhalb der Einrichtung durch:
Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen für Fachkräfte, um Sensibilität und Handlungsfähigkeit im Umgang mit extremistischen Tendenzen zu stärken.
Einbindung der gesamten Gemeinschaft durch gemeinsame Aktivitäten, die den Zusammenhalt fördern.
Schaffung von Strukturen, in denen betroffene Personen ihre Anliegen und Probleme offen ansprechen können, ohne Angst vor Stigmatisierung oder Repression.
Durch dieses strukturierte Vorgehen können sowohl die akuten Herausforderungen bewältigt als auch langfristig ein sicheres und inklusives Umfeld geschaffen werden, das extremistischen Tendenzen wirksam entgegenwirkt.
Fazit
Antisemitismus kann sich in verschiedenen Formen zeigen - von offenen Gewaltaufrufen über Verschwörungstheorien bis hin zu subtileren Formen wie der Anwendung doppelter Standards gegenüber Israel. Als Fachkräfte müssen wir besonders aufmerksam sein für weniger offensichtliche Ausprägungen, wie das kollektive Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für Handlungen Israels oder die Verwendung antisemitischer Stereotype in der Kritik an israelischer Politik.
Die IHRA-Definition bietet einen hilfreichen Rahmen, um antisemitische Äußerungen und Handlungen zu identifizieren. Sie umfasst sowohl traditionelle als auch moderne Formen des Antisemitismus und berücksichtigt dabei auch Erscheinungsformen, die sich gegen den Staat Israel richten können. Besonders wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen legitimer Kritik an Israel und antisemitischen Äußerungen.
Um Antisemitismus in der Sozialen Arbeit wirksam zu begegnen, ist ein mehrstufiger Ansatz hilfreich. Dies umfasst sofortige Interventionen zum Schutz Betroffener, zeitnahe Aufklärungsgespräche sowie langfristige Präventionsmaßnahmen durch Bildungsarbeit und Projekte zur Förderung von Toleranz und Verständnis. So können wir antisemitische Tendenzen frühzeitig erkennen und aktiv dagegen vorgehen.
Quellenangaben
Amnesty International. (2022). Israel's apartheid against Palestinians: Cruel system of domination and crime against humanity. https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/5141/2022/en/
Bernstein, J. (2020). Antisemitismus an Schulen in Deutschland: Befunde – Analysen – Handlungsoptionen. Beltz Juventa.
Boxerman, A. (2022, 21. Februar). Khaled Kabub sworn in as first Muslim Supreme Court justice. The Times of Israel. https://www.timesofisrael.com/khaled-kabub-sworn-in-as-supreme-courts-first-muslim-justice
Bundesverband RIAS. (2023). Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2022. Bundesverband RIAS e.V.
Chernivsky, M. & Wiegemann, R. (2017). Antisemitismus als individuelle Erfahrung und soziales Phänomen: Zwischen Bildung, Beratung und Empowerment. In M. Chernivsky, V. Peaceman & J. Scheuring (Hrsg.), Methodenhandbuch zum Thema Antisemitismus für die Jugendarbeit (S. 32-50). ZWST.
Feldman, D. (2021). The Jerusalem Declaration on Antisemitism: A new tool to fight antisemitism. Contemporary Jewry, 41(3), 437–449.
Friedländer, S. (2008). Das Dritte Reich und die Juden: Die Jahre der Verfolgung 1933–1939 (Bd. 1). C.H.Beck.
Human Rights Watch (2021). A threshold crossed: Israeli authorities and the crimes of apartheid and persecution. https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution
International Holocaust Remembrance Alliance (2016). Arbeitsdefinition von Antisemitismus. https://www.holocaustremembrance.com/de/resources/working-definitions-charters/arbeitsdefinition-von-antisemitismus
Lipstadt, D. E. (2022). Antisemitism: Here and now. Schocken Books.
Salzborn, S. (2020). Globaler Antisemitismus: Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne. Beltz Juventa.
Salzborn, S. & Kurth, A. (2019). Antisemitismus in der Schule: Erkenntnisstand und Handlungsperspektiven. In S. Salzborn (Hrsg.), Schule und Antisemitismus: Politische Bestandsaufnahme und pädagogische Handlungsmöglichkeiten (S. 299-318). Beltz Juventa.
Schwarz-Friesel, M. (2019). Judenhass im Internet: Antisemitismus als kulturelle Konstante und kollektives Gefühl. Hentrich & Hentrich.
Stern, K. S. (2019). The working definition of anti-Semitism: A reappraisal. In A. H. Rosenfeld (Hrsg.), Anti-Zionism and antisemitism: The dynamics of delegitimization (S. 11–26). Indiana University Press.
Stolberg, S. G. (2019, 4. März). Ilhan Omar's Criticism Raises the Question: Is Aipac Too Powerful? The New York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/04/us/politics/aipac-congress-democrats.html
Williams, D. & Ayres, M. (2024, 18. Februar). Brazil's Lula compares Israeli actions in Gaza to HolocaustIsrael incensed after Brazil's Lula likens Gaza war to Holocaust. Reuters. https://www.reuters.com/world/israel-incensed-after-brazils-lula-likens-gaza-war-holocaust-2024-02-18/
Zick, A., Küpper, B. & Krause, D. (2017). Gespaltene Mitte - Feindselige Zustände: Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland 2016. Dietz.
Fortbildungen
Joel Roerick bietet Fortbildungen zu Antisemitismus und Rechtspopulismus in der Sozialen Arbeit an. Bei Interesse schreibt eine Email an joel@konsent.berlin