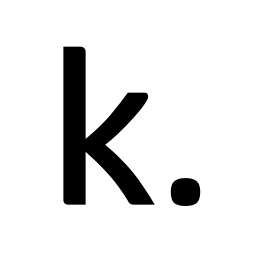Buurtzorg
Ist das Buurtzorg-Modell auf das Betreute Wohnen übertragbar?
Mit diesem Text möchte ich das Organisationsmodell des niederländischen Hauspflege-Unternehmens Buurtzorg auf das Betreute Wohnen in der Eingliederungshilfe übertragen. Buurtzorg ist u.a. durch den Bestseller „Reinventing Organizations“ (Laloux 2014; 2015; in illustrierter Kurzform 2016; 2017) als Musterbeispiel eines selbstorganisierten Unternehmens bekannt geworden. Nach Laloux ist Buurtzorg „das beste Fallbeispiel, um den Übergang vom heute vorherrschenden Organisationsmodell (modern-leistungsorientiert) zum neu entstehenden Paradigma integraler evolutionärer Organisationen zu beschreiben“ (Laloux 2015:61).
Für den freien Träger der Eingliederungshilfe, für den ich im Betreuten Wohnen arbeite, ist Buurtzorg eines unter mehreren Vorbildern in der Umstrukturierung der Organisation in ein nicht-hierarchisches, selbstorganisiertes Unternehmen. Mit der Arbeit möchte ich die Grundbedingungen von Buurtzorg und die Erfolgsfaktoren verstehen sowie auf die Umsetzbarkeit im Rahmen eines freien Trägers der Eingliederungshilfe vor allem mit Blick auf das Betreute Wohnen prüfen.
Die Fragen, denen ich in diesem Text nachgehe, sind:
- Was macht die Erfolgsgeschichte von Buurtzorg aus? Was sind die Rahmenbedingungen?
- Was würde eine Übertragung des Buurtzorg-Modells auf einen freien Träger der Eingliederungshilfe unter ganz anderen Rahmenbedingungen bedeuten?
- Welche Empfehlungen könnten für eine Implementierung des Buurtzorg-Modells in der Eingliederungshilfe ausgesprochen und zukünftig genauer untersucht werden?
Ich sehe zwei Schwierigkeiten bei der Bearbeitung:
1. Die Rahmenbedingungen von niederländischer Hauskrankenpflege und Berliner Eingliederungshilfe sind kaum vergleichbar. Wesentliche Faktoren, die das Erfolgsmodell von Buurtzorg ausmachen – so die berühmte Tasse Kaffee mit den Adressat*innen, auf die zu sprechen kommen sein wird –, sind bereits Grundbestandteil der Eingliederungshilfe. Andere Faktoren sind vermutlich kaum übertragbar, da die Hauskrankenpflege in einem klarer abgegrenzten Rahmen arbeitet als die Eingliederungshilfe. Insbesondere von Bedeutung ist hier der Unterschied zwischen medizinischer und sozialer Diagnostik.
2. Das Buurtzorg-Modell ist nur bedingt erforscht ist und viele notwendige Informationen schwer oder gar nicht zugänglich sind. Die Arbeit wird somit an vielen Stellen mit Hypothesen arbeiten müssen.
Ich versuche beide Probleme kreativ in den Schreibprozess einzuarbeiten und hoffe, dass die Thematik Impulse für zukünftige Entwicklungen in der Eingliederungshilfe geben kann. In dieser Arbeit liegt mein Fokus ausdrücklich auf dem Buurtzorg-Modell und nicht auf anderen, eventuell gar praktikableren Modellen der New Work. Im ersten Kapitel schaue ich auf die unterschiedlichen Ausgangsbedingungen bei Buurtzorg und in der Eingliederungshilfe, im ausführlichen zweiten Kapitel beschreibe und reflektiere ich Buurtzorg in seiner Entstehungsgeschichte und als Modell.
Zur Vereinheitlichung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten in der Krankenpflege und in der Sozialen Arbeite verwende ich den Begriff „Mitarbeiter*innen“ für Krankenpfleger*innen und sozialarbeiterische Fachkräfte, den Begriff „Adressat*innen“ für Patient*innen und Klient*innen, mit Ausnahme von Aussagen, die sich ausschließlich auf einen der beiden Bereiche beziehen.
Ausgangsbedingungen
Bevor ich auf das Buurtzorg-Modell eingehe, möchte ich die sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen des Betreuten Wohnens in Berlin und Deutschland sowie die Hauskrankenpflege in den Niederlanden einander gegenüberstellen, da diese für die weitere Reflexion grundlegend sind.
Betreutes Wohnen in Berlin
Das Betreute Wohnen kannte seit seiner Entstehung im Rahmen der Enthospitalisierung in den 90er-Jahren (vgl. Auer 1999:15ff.; Forster 1997:19ff.) eine große sozialarbeiterische Freiheit mit in meiner Erfahrung wenigen Reglementierungen durch die Sozialämter als Leistungs- und Kostenträger. Es ist eine ambulante Hilfe, wenn auch vor allem im Intensiv Betreuten Wohnen nicht selten Therapeutische Wohngemeinschaften vorkommen, die stationär wirken und sich kaum von Heimen unterscheiden (vgl. Auer 1999:48). Tamm (2015:69ff.) legt dar, wie im Rahmen der ambulanten Wohnbetreuung seit jeher gemeinsames Kaffeetrinken von Fachkräften und Adressat*innen ein „wichtiges Ereignis im Betreuungsalltag der KlientInnen“ gewesen sei und dadurch „Nähe, eine Vertrauensbasis und Sicherheit“ geschaffen würden (ebd.:71). Ein wesentliches Novum bei Buurtzorg ist, wie wir später sehen werden, eben das gemeinsame Kaffeetrinken.
Aktuell ändert sich die Situation mit der BTHG-Umsetzung schrittweise und stellt für Fachkräfte und Organisationen neue, bislang kaum gelöste Anforderungen (vgl. Rosemann 2018; Schubert et al. 2016; Stilling 2016). Im Rahmen der BTHG-Umsetzung wird die International Classification of Functioning (ICF) als Grundlage einer sozialen Diagnostik eingeführt (vgl. DIMDI 2005; Seidel & Schneider 2021), in Berlin im Rahmen des Teilhabeinstruments Berlin (TIB) (vgl. Schäfers 2020:6ff.; 12ff.). Mit der BTHG-Umsetzung kommen außerdem Anforderungen eines komplexen Qualitätsmanagements, in dem hauptsächlich Fragen der Prozess- und Ergebnisqualität weitreichende Auswirkungen auf den sozialarbeiterischen Alltag haben werden: Strukturierte Dokumentation „unter Formulierung und Berücksichtigung von Wirkannahmen“ (BAGüS 2021:3), Partizipation, Sozialraumorientierung und andere, dem aktuellen Stand der fachlichen Diskussion entsprechende Haltungen, Ansätze und Methoden müssen nachweisbar im Arbeitsalltag verankert sein (ebd.: 4). Zielerreichung soll sowohl auf individueller Ebene der einzelnen Adressat*innen als auch in Form von trägerweiten Quoten nachweisbar sein (ebd.: 5). Eine weitere Herausforderung wird die bislang verschwommene Grenze zwischen Leistungen der Eingliederungshilfe und der Krankenpflege sein, die zukünftig neu definiert werden soll (vgl. Konrad 2019:45f.). Bereits früh in der Diskussion um die BTHG-Umsetzung mahnte der Paritätische Wohlfahrtsverband die Gefahr von beabsichtigten Kostensenkungen an (vgl. Stilling 2016).
Neben der BTHG-Umsetzung ist der eklatante Fachkräftemangel eine hochaktuelle Herausforderung. Die Soziale Arbeit führt aktuell die Statistik unbesetzter Stellen (Hickmann & Koneberg 2022:1). Hinzu kommen die Folgen mangelnder emotionaler Bindung der Mitarbeiter*innen. Auch wenn hierzu keine professionsbezogenen Forschungsergebnisse vorliegen, so ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse des Gallup Engagement Index für Deutschland auch im Bereich der Sozialen Arbeit Gültigkeit haben. Gallup kommt zu dem Schluss, dass die „emotionale Bindung von Deutschlands Beschäftigten an ihren Arbeitgeber (…) auf dem tiefsten Stand seit 2012“ sei (Gallup 2023:3).
Eine auch in der Eingliederungshilfe beobachtbare „Pathologie“ beschreiben Breidenbach & Rollow: Führungskräfte wollen häufig gar nicht führen und fühlten sich deshalb von Prinzipien der Selbstorganisation besonders angezogen. Schwache Führung bei der Implementierung von Selbstorganisation stelle jedoch ein paradoxerweise ein wesentliches Hindernis dar (Breidenbach & Rollow 2019:52).
Hiermit sind eine ganze Reihe an Problematiken in der Ausgangssituation der Eingliederungshilfe skizziert. Schauen wir jetzt, wie die Anfänge bei Buurtzorg aussahen.
Hauskrankenpflege in den Niederlanden
Das Hauskrankenpflegesystem hat in den Niederlanden eine lange Tradition. Unabhängige Krankenschwestern, die seit dem 18. Jahrhundert jeweils eine Nachbarschaft versorgten und eng mit Ärtz*innen und Krankenhäusern zusammenarbeiteten, wurden mit dem Ziel der Kostensenkung in den 1980er-Jahren in größeren Organisationen zusammengefasst, die sich im Laufe der Jahre zu noch größeren Unternehmen zusammenschlossen. Diese Organisationen waren zunehmend von klassischem Managementdenken beeinflusst. Zu den Veränderungen gehörte, dass nicht mehr eine einzige Pflegekraft für die Patient*innen einer Nachbarschaft zuständig war. Stattdessen wurde ein effizientes Rotationssystem abhängig von Spezialisierung und Verfügbarkeit eingeführt, das zur Folge hatte, dass jede Patient*in von mehreren Pflegekräften abwechselnd betreut wurde. Zur Effizienzsteigerung wurden Normzeiten für sämtliche Routinehandlungen eingeführt, die Planung des Tagesablaufs lag nicht mehr in den Händen der Pflegekräfte, sondern wurde zentral durch Planungsabteilungen ausgeführt, an Wohnungstüren der Patient*innen wurden Barcodes angebracht, die Pflegekräfte zu Kontrollzwecken scannen mussten und klare Unternehmenshierarchien mit mehreren Managementebenen wurden eingerichtet (vgl. Laloux 2015:61ff.; 2017:42ff.).
Jos Blok, der Gründer von Buurtzorg, der selbst als Pflegekraft in der niederländischen Hauskrankenpflege gearbeitet hatte (vgl. Laloux 2017:47) beschreibt, wie ihm und seinen Mitstreiter*innen zunehmend klar wurde, dass „die negativen Konsequenzen des ‚Managementdenkens‘ einen immer größeren Einfluss auf die tägliche Arbeit von professionellen Fachkräften ausübten“ und er beobachtet „direkte und ernsthafte Folgen für die Gesundheitsversorgung der Patienten“ (Jos Blok in Vermeer & Wenting 2018b:5). „Das System“, so Laloux, „hatte die Patienten als Menschen vernachlässigt; die Patienten wurden zu Kunden, denen man Produkte verkauft“ (Laloux 2015:62).
Vergleich
Für den Vergleich sind zwei Meilensteine in der Eingliederungshilfe relevant: die Enthospitalisierung der psychiatrischen Anstalten in den 90er-Jahren und die aktuelle, in der Entwicklung befindliche BTHG-Umsetzung.
Im Vergleich der Ausgangssituationen der niederländischen Hauskrankenpflege und des Betreuten Wohnens in Berlin und Deutschland ist zunächst ein diametral entgegengesetzter Trend zu erkennen: hat sich die Entwicklung in den Niederlanden von einer individuellen Versorgung in den Nachbarschaften hin zu einer anonymen Organisationsform entwickelt, so ist im Betreuten Wohnen zunächst das absolute Gegenteil passiert: von der Unterbringung in staatlich organisierten psychiatrischen Anstalten hin zu individuellen Wohnformen in der gemeindenahen sozial-psychiatrischen Versorgung, organisiert durch freie Träger der Eingliederungshilfe.
Herausforderungen, die die Hauskrankenpflege in den Niederlanden in den 1980er und 90er Jahren erlebt hat, stehen in der Eingliederungshilfe eventuell momentan durch die BTHG-Umsetzung bevor, vorwiegend mit Bezug auf neue Regelungen zum Qualitätsmanagement und befürchtete Kosteneinsparungen. Und zugleich bietet das Betreute Wohnen sowohl bislang als auch mit Blick auf die BTHG-Umsetzung Perspektiven, die Buurtzorg für die niederländische Hauskrankenpflege erst entwickeln musste. So sei an dieser Stelle hypothetisch angemerkt, dass die neue Art der Leistungsvergabe sowie die Kontrolle der Leistungserbringer klar an eine Entwicklung erinnert, die Laloux bezüglich der Hauskrankenpflege in den Niederlanden beschreibt: Es könnte geschehen, dass auch in der Eingliederungshilfe die Adressat*innen zu Kunden werden, denen man Produkte verkauft. Auch erscheint mir fraglich, ob viele, vor allem kleinere Leistungserbringer die Reformen durch das BTHG langfristig überleben werden, oder ob hier ebenfalls eine Konzentration auf die großen, überregionalen Träger der Eingliederungshilfe stattfinden wird. Ob das System der Eingliederungshilfe dann noch seine Adressat*innen als Menschen sehen kann, erscheint mir fraglich. Der Vergleich zur niederländischen Entwicklung zum Ende des 20. Jahrhunderts kann also als eine Warnung verstanden werden.
Buurtzorg Modell
Bevor ich im dritten Teil die Anwendbarkeit des Buurtzorg-Modells auf das Betreute Wohnen diskutiere, werde ich nun erst einmal das Buurtzorg vorstellen und dabei auf seine Entstehungsgeschichte, Merkmale und Kritik eingehen.
Entstehungsgeschichte
Jos Blok gründete im Jahr 2006 gemeinsam mit den Trainer*innen Astrid Vermeer und Horst Wenting die Buurtzorg-Hauskrankenpflege (vgl. Jos Blok in Vermeer & Wenting 2018b:5). In seiner beruflichen Laufbahn zunächst als Hauskrankenpfleger und dann in Leitungsfunktionen in Krankenpflegeunternehmen kam er zu dem Schluss, dass er in einem mehr und mehr tayloristischen und hierarchisch organisierten System keine Veränderungen von innen herbeiführen könnte. So entschloss er sich, eine Organisation nach seinen eigenen Vorstellungen von Grund auf aufzubauen (vgl. Laloux 2015:62; Bernstein et al. 2022:3).
Das Gründungsteam bestand aus zehn Krankenpfleger*innen, denen Blok selbst sich anschloss, um zu sehen, wie sich seine Idee im Arbeitsalltag umsetzen würde (vgl. Bernstein et al. 2022:3). Die Wachstumsrate in den Folgejahren war rasant und unvergleichlich. Zu Spitzenzeiten wuchs das Unternehmen trotz eines zunehmenden Fachkräftemangels um etwa 1.000 Mitarbeiter*innen pro Jahr (vgl. Wasel & Haas 2018:595; KPMG 2016:15). Im Jahr 2022 hatte Buurtzorg über 10.000 Krankenpfleger*innen in etwa 900 Teams und eine unvergleichlich schlanke Verwaltung mit 50 Mitarbeiter*innen sowie zwei Geschäftsführer*innen (vgl. Bernstein et al. 2022:1).
Neben der Hauskrankenpflege hat Buurtzorg seit 2009 weitere Tätigkeitsbereiche entwickelt, darunter Hauswirtschaftliche Unterstützung, Betreutes Wohnen, Hospize, Pflegeheime, Jugend- und Familienhilfeeinrichtungen (vgl. Bernstein et al. 2022:20). Diese neueren Tätigkeitsbereiche sind in der Literatur leider nicht genauer dargestellt, zumal ihre Analyse beim Übertrag des Buurtzorg-Modells auf die Soziale Arbeit besonders hilfreich wäre.
Neben Projekten in vielen anderen Ländern entstanden auch in Deutschland seit 2018 Projekte nach dem Vorbild Buurtzorgs, die allerdings enorme Startschwierigkeiten hatten, worauf ich später noch zu sprechen kommen werde (vgl. Hiob et al. 2022:136ff.; Janning 2022:26).
Merkmale
Die Beschreibung und Analyse von Buurtzorg könnten Bücher füllen. Vermeer & Wenting, mit denen Blok das Buurtzorg-Modell entwickelte, haben den Ansatz in drei unterschiedlichen Praxisbüchern, die jedes für sich lehrreich sind, präsentiert (vgl. Vermeer & Wenting 2018b; 2018c; 2018a). Auf die weitreichenden Inhalte der Praxisbücher werde ich hier nicht eingehen, sondern nur übersichtsweise die elementaren Merkmale von Buurtzorg zusammenfassen. Ich werde zunächst fragen, was die Arbeitsweise von Buurtzorg ausmacht, um dann die Unternehmensstrukturen darzustellen und abschließend auf IT-basierte Hilfsmittel und die Frage der Evaluation zu kommen.
Arbeitsweise
Durch die Rezeption von Laloux‘ Darstellung von Buurtzorg als Musterbeispiel eines selbstorganisierten Unternehmens wird der Pflegedienstleister in der Regel vor allem unter dem Aspekt der Selbstorganisation betrachtet. Doch spielen weitere Faktoren in der Arbeitsweise eine wichtige Rolle. So stellen Wasel & Hasse fest, dass „nach Aussagen vieler Nutzer, aber auch wohlwollender und konkurrierender Anbieter (…) die eigentliche Neuerung in dem gelebten Pflegemodell“ bestehe (Wasel & Haas 2018:600). Buurtzorg revolutioniere die Hauskrankenpflege „durch eine ganzheitliche und sozialräumlich eingebundene Zuwendung (…), die dezidiert bei der Patientin/dem Patienten, ihren Ressourcen und ihrem Willen ansetzt“ (Wasel & Haas 2018:595). Der Fokus liegt nicht auf medizinischer Versorgung, sondern auf Erwerb oder Erhalt von Selbständigkeit der Adressat*innen, wobei vor allem auch die Nachbarschaft und das familiäre Umfeld einbezogen werden (vgl. Laloux 2015:64). Bei Bedarf stehen eine Reihe weiterer Unterstützungsdienste innerhalb der Buurtzorg-Organisation zur Verfügung: sozial-psychiatrische Betreuung, Haushaltshilfe, Kinder- und Jugendhilfe sowie Physio- und Ergotherapie (vgl. Hiob et al. 2022:131). Der Imperativ über all dem ist, dass ich Buurtzorg-Mitarbeiter*innen so schnell wie möglich selbst überflüssig machen möchten, in dem sie auf die Gesamtsituation der Adressat*innen schauen, anstelle Teilaufgaben mechanistisch zu wiederholen (vgl. KPMG 2016:14).
Die theoretische und praktische Basis für die ganzheitliche, interdisziplinäre und sozialräumlich orientierte Betreuung der Buurtzorg-Adressat*innen bildet das OMAHA-System (vgl. Hiob et al. 2022:132). Das OMAHA-System, das bestimmend für die Buurtzorg-Arbeit ist, ist ein Klassifikationssystem, das vergleichbar der ICF nicht nur medizinische Aspekte, sondern auch soziale und persönliche Aspekte abbildet. Anders als die ICF hat das OMAHA-System keinen Anspruch auf universelle Gültigkeit, sondern wurde für die Berufspraxis in der Hauskrankenpflege entwickelt. Es umfasst neben einer medizinischen und sozialen Diagnostik auch einen breit gefächerten Maßnahmenkatalog und eine statistisch auswertbare Systematik für die Leistungsdokumentation (vgl. Martin 2005:23ff.). M. E. ist das OMAHA-System der zentrale Faktor in Organisation und (Selbst-)Steuerung von Buurtzorg. Leider gibt es zur Implementierung und Evaluation des OMAHA-Systems bei Buurtzorg keine weiterreichende Literatur.
Auf der klar strukturierten und umfassenden Systematik des OMAHA-Systems basierend findet eine selbstorganisierte Arbeit der Mitarbeiter*innen statt, die jedoch ohne die solide Basis von OMAHA m. E. nicht machbar wäre. In der Analyse bisheriger Managementstrukturen in der Hauskrankenpflege erkannte Blok zusammen mit Vermeer & Wenting, dass „Selbstmanagement und Selbstorganisation das ideale Führungsmodell für eine Organisation darstellen“ (Jos Blok in Vermeer & Wenting 2018b:5). Übermäßige „Kontrolle, Protokolle und Regeln“ vertragen sich in der Sicht von Blok nicht mit „Vertrauen in Menschen, die ihre Arbeit so gut wie möglich erledigen möchten“ (Jos Blok in Vermeer & Wenting 2018b:5). Somit liegen viele Entscheidungen bei Buurtzorg in den Händen der Mitarbeiter*innen, die jedoch gut auf diese vielen ungewohnten Freiheiten vorbereitet werden: „Alle neu gebildeten Teams und alle neu eingestellten Mitarbeiter durchlaufen einen Fortbildungskurs mit dem Titel ‚Lösungsorientierte Interaktionsmethoden‘“ (Laloux 2015:66; vgl. Vermeer & Wenting 2018b:116) und werden in Konfliktlösung und Gewaltfreier Kommunikation trainiert (vgl. Laloux 2015:178).
Weitere Techniken sind festgelegte Besprechungsformate, die auf Effizienz ausgelegt sind und endlose Suchen nach Konsens begrenzen (vgl. Laloux 2015:166), verschiedene Formate der Kollegialen Beratung (vgl. ebd.:158) und eine Entscheidungsfindungsmethode, die andernorts „Konsent“ genannt wird (vgl. ebd. 2015:66; Rau & Koch-Gonzalez 2018:83ff.). Laloux beschreibt anschaulich eine solche Konsent-basierte Teambesprechung bei Buurtzorg:
„Betrachten wir als Beispiel eine Teambesprechung, in der wichtige Entscheidungen getroffen oder Probleme gelöst werden müssen. Wenn kein Vorgesetzter im Raum ist, dann hat niemand das Sagen oder das letzte Wort. Stattdessen nutzen die Teams bei Buurtzorg eine sehr präzise und effiziente Methode für gemeinsame Problemlösung und Entscheidungsfindung. Als Erstes wählt die Gruppe einen Moderator für die Besprechung. Die zu besprechenden Punkte werden direkt im Meeting zusammengestellt und basieren somit auf dem, was die Teammitglieder zu diesem Zeitpunkt beschäftigt. Die Moderatorin hat nicht die Aufgabe, ihre Meinung zu sagen, Empfehlungen zu geben oder Entscheidungen zu treffen, sie stellt einfach Fragen: ‚Was schlägst du vor?‘ oder ‚Aus welchem Grund machst du diesen Vorschlag?‘ Alle Vorschläge werden auf ein Flipchart geschrieben. In einer zweiten Runde werden die Vorschläge noch einmal durchgesehen, geklärt und ergänzt. In einer dritten Runde werden die Vorschläge in die Gruppe gebracht, um darüber zu entscheiden. Die Grundlage für die Entscheidungsfindung ist nicht Konsens. Damit eine Entscheidung angenommen wird, reicht es aus, dass niemand einen prinzipiellen Einwand hat. Ein Teammitglied kann kein Veto gegen eine Entscheidung einlegen, weil sie oder er das Gefühl hat, dass eine andere Entscheidung (meist die eigene!) besser wäre. Die perfekte Entscheidung, hinter der alle hundertprozentig stehen können, gibt es vielleicht nicht. Und wenn man versuchen würde, zu solch einer Entscheidung zu kommen, könnte dies sehr erschöpfend sein. Solange es keinen prinzipiellen Einwand gibt, wird eine Lösung angenommen – mit dem Einverständnis, dass sie jederzeit neu betrachtet werden kann, wenn neue Informationen dazu auftauchen.“ (Laloux 2015:66)
Mit dieser Besprechungsform werden ein wesentliches Problem gelöst, das im selbstorganisierten Arbeiten auftreten kann: Dominanz oder Boykott durch Einzelne. Stattdessen wird
„jede Stimme (…) gehört, die kollektive Intelligenz beeinflusst die Entscheidungsfindung und kein Beteiligter kann den Prozess boykottieren und die anderen blockieren, um ihnen eigene persönliche Vorlieben aufzuzwingen.“ (Laloux 2016:66)
Ein weiterer Aspekt, der die Arbeitsweise von Buurtzorg ausmacht, ist ein hohes Maß an Individualität. Private Notwendigkeiten wie Zeit für die Familie stehen ganz oben in der Teamplanung (vgl. Laloux 2015:185), die Mitarbeiter*innen gestalten und dekorieren die Büros nach ihren eigenen Vorstellungen (vgl. ebd.:170). Das Kompetenzprofil für jährliche Mitarbeiter*innen-Evaluationen arbeiten die Teams selbst aus und sie entscheiden auch, in welcher Form sie Evaluationsgespräche durchführen möchten (vgl. ebd.: 2015:127)
Struktur
Die Organisationsstruktur von Buurtzorg ist denkbar einfach: selbstgesteuerte Teams ohne Leitung, Coaches und sog. „regionale Berater*innen“, eine schlanke Verwaltung und eine Geschäftsführung.
Die Geschäftsführung hat vor allem eine Repräsentanten-Funktion nach außen, berät die Mitarbeiter*innen bei Bedarf, hält sich jedoch grundsätzlich aus Entscheidungen heraus. (vgl. Wasel & Haas 2018:600).
Der Verwaltungsapparat ist zuständig für sämtliche übergreifenden administrativen Aufgaben wie „Kundenadministration, Projektarbeit, Bearbeitung strategische Anfragen, Vertragsmanagement, Personalverwaltung und Buchhaltung“ (Hiob et al. 2022:131).
Regionale Berater*innen, auch Coaches genannt, entsprechen dem mittleren Management in klassischen Organisationen. Sie haben jedoch keine Weisungsbefugnis, sondern unterstützen Teams in der Entscheidungsfindung, sind ebenfalls Pflegekräfte mit einer Zusatzqualifizierung in Konfliktmanagement und verdienen nicht mehr als die anderen Mitarbeiter*innen. Dabei halten sie eigene Meinungen und Lösungen zurück und moderieren den Teamprozess (vgl. Laloux 2015:68; Wasel & Haas 2018:600; Vermeer & Wenting 2018a:35ff.). Ein einziger Coach ist für die Beratung von bis zu 50 Teams zuständig und hat mit jedem Team ein bis zweimal jährlich ein fest angesetztes Treffen. Die Hauptaufgabe der Coaches besteht nicht in regelmäßiger Arbeit mit den Teams, sondern in Problemlösung und Kriseninterventionen im Bedarfsfall (vgl. Bernstein et al. 2022:7).
Die Teams bestehen aus zehn bis maximal zwölf Mitarbeiter*innen, die sämtliche Entscheidungen kollektiv treffen und für alle mit der Arbeit zusammenhängenden Prozesse verantwortlich sind, von der Pflege selbst über Aufnahme von Patient*innen, Evaluation der Team-Produktivität, Dienst-, Urlaubs- und Fortbildungsplanungen, die Bürosuche und Raumgestaltung. Ohne feste Leitung rotieren die unterschiedlichen Rollen unter den Mitarbeiter*innen (vgl. Laloux 2015:63f.; Wasel & Haas 2018:600). Bei Buurtzorg Deutschland gibt es aufgrund der rechtlichen Anforderungen eine formal benannte Pflegedienstleitung. Ein Mitarbeiter, der diese Rolle übernimmt, beschreibt dies so:
"Ich bin Pflegedienstleitung (…) auf dem Papier. Das heißt nicht, dass ich irgendwas zu sagen habe, sondern wir entscheiden trotzdem alles gemeinsam. Aber rein rechtlich gesehen brauchen wir in Deutschland so was. Das ist notwendig, weil es in Deutschland keine eigene Rechtsform für Betriebe ohne Vorgesetzte gibt. Im Schadensfall haftet nicht die Leitung auf dem Papier. Buurtzorg ist entsprechend versichert.“ (Stadter 2021:00:17:00ff.)
Auch wenn es sich so anhört, als wären alle Mitarbeiter*innen bei Buurtzorg „gleich“, so ist dem nicht so. Zwar gibt es keine Hierarchien, wohl aber Spezialisierungen nach Fähigkeiten und Erfahrungen der Mitarbeiter*innen. Dabei kann es sein, dass einige Mitarbeiter*innen auch von anderen Teams zurate gezogen werden, weil sie in besonderes Fachwissen oder eine besondere Kompetenz besitzen. So entstehen „natürliche und spontane Hierarchien (…), die auf Anerkennung, Einfluss und Fertigkeiten basieren“ (Laloux 2015:67).
Auch die Gruppenprozesse sind nicht als grundsätzlich hierarchiefrei zu bezeichnen. So gibt es im Team klar festgelegte Rolle, die jedoch durch ein Rotationsprinzip flexibel gehalten werden. Die Evaluation der Teamleistung findet auf Augenhöhe unter den Teammitgliedern statt, ein IT-basiertes Benchmarking der Teamleistungen fördert Transparenz und ist ein für alle einsehbares Instrument der Leistungsermittlung. Hier findet ein Paradigmenwechsel von hierarchischer Kontrolle hin zur Selbstkontrolle der Teams statt (vgl. Wasel & Haas 2018:600).
Hilfsmittel
Um diese Art von transparenter und gewissermaßen vorstrukturierter Selbstorganisation und -kontrolle effizient und kohärent zu gestalten, arbeitet Buurtzorg mit einem IT-System namens „Buurtzorg Web“, das neben ausgefeilten Kommunikations-, Informations- und Planungstools auf Basis des oben bereits erwähnten OMAHA-Systems eine standardisierte soziale und medizinische Diagnostik, die Behandlungsformen, Dokumentation und Auswertung strukturiert und die erfassten Informationen organisationsweit verfügbar macht. „Buurtzorg Web“ kann damit als die eigentliche und zentrale organisatorische Ressource von Buurtzorg verstanden werden (vgl. Hiob et al. 2022:132; Bernstein et al. 2022:9). Sämtliche Daten werden in der gesamten Organisation nicht anonymisiert verfügbar gemacht, das umfasst auch weniger positive Resultate, denn:
„Den Mitarbeitern wird das Vertrauen entgegengebracht, dass sie mit guten und schlechten Neuigkeiten umgehen können. Es gibt keine Kultur der Angst, deshalb müssen Teams mit schlechten Resultaten nicht den Schutz der Anonymität suchen. Den Teams, die durch eine schwierige Phase gehen, wird das Vertrauen entgegengebracht, dass sie sich der Situation stellen und nach Lösungen suchen.“ (Laloux 2015:111)
Diese transparente Fehlerkultur ermöglicht, dass dann Teams, die Schwierigkeiten begegnen, sich Unterstützung bei anderen Teams holen können (vgl. Laloux 2015:112). Eine Schlüsselrolle spielt bei der Suche nach Unterstützung das Intranet, über das Teams nach Rat und Unterstützung suchen können (vgl. ebd.:67).
Diese kurze und alles andere als vollständige Übersicht über die Merkmale von Buurtzorg zeigt, wie komplex die Organisation angelegt ist. Vieles, aber nicht alles bewegt sich um den Aspekt der Selbstorganisation. Vor allem wird erkennbar, dass Selbstorganisation nicht im leeren Raum stattfindet, sondern einen klar strukturierten Rahmen benötigt, der vermutlich durchdachter und strukturierter sein muss als in herkömmlichen Hierarchien. Hiervon ausgehend möchte ich kurz das Erfolgsmodell „Buurtzorg“ kritisch reflektieren.
Reflexion
In einer kurzen kritischen Reflexion des Buurtzorg-Modells werde ich auf drei Bereiche schauen: Selbstorganisation, Rahmenbedingungen und Ökonomie.
Selbstorganisation
Buurtzorg scheint weitgehend „ohne Hierarchie, Macht, Kontrolle, Eingriffe etc.“ auszukommen. Doch Wasel & Haas legen dar, dass dieser Schluss vorschnell ist:
„Denn die in anderen Organisationen bestimmten Hierarchien zugeordneten Entscheidungsbefugnisse sind nicht einfach in hierarchiefreie Gruppenprozesse überführt worden. Vielmehr sind viele Entscheidungen durch strukturelle Festlegungen im Vorhinein geklärt worden.“ (Wasel & Haas 2018:600)
Somit könnte man sagen, dass die Selbstorganisation nur funktioniert, da Buurtzorg mit Jos Blok einen charismatischen und visionären Gründer hat, der vieles auf zentralistische Art und Weise vorgegeben hat und auch weiterhin vorgibt und regelt, dabei jedoch an der Basis eine gewisse Gestaltungsfreiheit ermöglicht. Bemerkenswert ist, dass Buurtzorg eine starke Position in Politik und Medien hat und dadurch Rahmenbedingungen schaffen kann, die für die Entwicklung von Buurtzorg notwendig sind und ohne so Blok als starke Führungsfigur sicher nicht denkbar wären (vgl. Bernstein et al. 2022:8). Des Weiteren hat Blok von Anbeginn die Entwicklung einer einzigartigen IT-Infrastruktur gefördert und dadurch „viele der Entscheidungsprozesse durch strukturelle Vorgaben überflüssig“ gemacht (Wasel & Haas 2019:36). Kritisch betrachtet findet also eine klare Einschränkung der Selbstorganisation statt.
Der Kulturwandel in Richtung einer selbstorganisierten Arbeitsweise stellt die Mitarbeiter*innen stellenweise vor erhebliche Probleme. Janning reflektiert das vorläufige Scheitern von Buurtzorg Deutschland mit Bezug auf die Herausforderung der Selbstorganisation:
„Das Verlassen der gewohnten Verhaltensweisen, heraus aus der hierarchisch geprägten Welt, hinein in die eigenverantwortlich gestaltete Welt, fällt schwer. (…) Das Tempo der Entwicklung war zu rasant. (…) Da auch ein großer Anteil wirtschaftliches Wissen und die Fähigkeit zu erkennen, ob das Team in wirtschaftlich gutem Fahrwasser treibt, Voraussetzung sind, wäre es wichtig gewesen, genau dieses Wissen zu vermitteln. (…) Jahrzehntelange starre, hierarchische Strukturen im Rekordtempo abzuschaffen, ist nicht möglich. (…) [Es benötigt] Zeit, gute Schulung, Geld und Geduld (…)“ (Janning 2022:26)
Konkrete Herausforderungen der Selbstorganisation beschreiben Vermeer & Wenting. Es geschehe in ihrer Erfahrung immer wieder, dass Einzelne eine Chefrolle einnehmen, dass Selbstorganisation durch zu viele Regeln und Verfahrensanweisungen gelähmt wird und dass grundlegende Voraussetzungen wie ein gesunder Regelspielraum oder ein gutes IT-System fehlen (vgl. Vermeer & Wenting 2018b:28). Aus dieser Perspektive kann das Regelsystem von Buurtzorg, das ich weiter oben kritisch betrachtet habe, auch als Grundvoraussetzung für Selbstorganisation gelten.
Unabhängig von einer kritischen Einordnung der spezifischen Selbstorganisation bei Buurtzorg kann man sich sicher verallgemeinernd Bernstein et. al. anschließen, die sagen, dass nicht jede*r gut zu Buurtzorg passt, so zum Beispiel „the person who doesn’t want to self-organize; the person who just wants to go to work and come home; the person who never speaks in meetings“ (Bernstein et al. 2022:4). So wird sich die eine oder andere Mitarbeiter*in aus einem selbstorganisierten Team verabschieden, wenn sie merken, dass diese Arbeitsweise nicht ihren Vorstellungen entspricht (vgl. Laloux 2015:129).
Mehrheitlich betrachtet scheint jedoch die Arbeitszufriedenheit durch Selbstorganisation zu steigen, Druck von oben scheint unnötig, wenn Mitarbeiter*innen mit Enthusiasmus arbeiten. Geht dieser verloren, so geht es in der Buurtzorg-Philosophie darum, an den Ursachen zu arbeiten und diesen wiederzufinden (vgl. Laloux 2015:125). Buurtzorg hat mit Prinzipien der Selbstorganisation und Mitbestimmung auch eine größere Finanzierungskrise überwinden können (vgl. Laloux 2015:105). Das könnte auf eine erhöhte Resilienz selbstorganisierter Unternehmen bei Herausforderungen und Krisen hinweisen.
Rahmenbedingungen
Wie oben schon genannt, scheint mir Selbstorganisation nicht das einzige Erfolgsmerkmal von Buurtzorg zu sein. Ebenso wichtig erscheint die Entwicklung eines neuen, sozialräumlich und ganzheitlich orientierten Modells von Pflege. Wasel & Haas warnen, „das Gelingen von Buurtzorg nicht auf ein gutes Geschäftsmodell zu beschränken, sondern zugleich die Rahmenbedingung ambulanter Pflege zu bedenken“ (Wasel & Haas 2019:35). Mit den durch Buurtzorg veränderten Rahmenbedingungen ist auch ein „Gefühl von Berufung“ bei den Mitarbeiter*innen zurückgekommen, das maßgeblich die Arbeitszufriedenheit steigert und dabei Faktoren wie Fehlzeiten und Mitarbeiter*innenfluktuation deutlich reduziert und trotz Fachkräftemangels Fachkräfte magnetisch anzieht (vgl. Laloux 2015:65).
Wie die zukünftige Entwicklung aussehen wird, ist dabei noch offen: Eine alternde Bevölkerung und immer noch zunehmender Fachkräftemangel können auch eine Organisation wie Buurtzorg an ihre Grenzen bringen. Die Frage, die sich hier stellt, wie sich ein wachsender Leistungsdruck mit der bislang entspannten Arbeitsatmosphäre von Buurtzorg vereinbaren lassen kann (vgl. Bernstein et al. 2022:11).
Der Transfer des Buurtzorg-Modells in andere Länder und Rahmenbedingungen gestaltet sich häufig nicht leicht (vgl. Bernstein et al. 2022:8). Hierzu gibt es bislang wenige fundierte Erkenntnisse und Studien. Die Ergebnisse einer Studie der Fachhochschule Münster in Kooperation mit dem Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen zur Implementierung des Buurtzorg-Modells in Deutschland wurde bislang noch nicht veröffentlicht (vgl. Fachhochschule Münster 2023).
Ökonomie
In viel zitierten Studien der Unternehmensberatungen KPMG und Ernst & Young wurde ermittelt, dass die Kundenzufriedenheit um 30 % höher ist als bei der Konkurrenz, 40 % weniger Pflegestunden notwendig sind, Fehlzeiten geringer, Verwaltungskosten und Kosten pro Patient um ein bis zwei Drittel niedriger waren, bei schnellerer Genesung der Patient*innen, weniger Einweisungen in die Notaufnahme und volkswirtschaftliche Einsparungen von etwa 2 Mrd. jährlich in, würden alle Krankenpflegeunternehmen in den Niederlanden mit dem gleichen Erfolg arbeiten (vgl. Bernstein et al. 2022:1; Laloux 2015:64f.; KPMG 2016:15). Laloux schreibt vom Paradox, dass Unternehmen wie Buurtzorg „fantastische Wachstumszahlen aufweisen können, obwohl sie nicht der modernen leistungsorientierten Fokussierung auf Wachstum folgen“ (Laloux 2015:197). Er erklärt dieses Paradox damit, dass gut gestaltete Selbstorganisation „unglaubliche Energie frei[setzt]. Wenn sich diese Energien mit einem noblen Sinn und einem tiefen Bedürfnis in der Welt verbinden, wie könnte dann etwas anderes als Wachstum die Folge sein?“ (a.a.O.). An dieser Aussage kann Kritik von zwei Seiten ansetzen: Ist Buurtzorg wirklich so ökonomisch erfolgreich wie oft dargestellt? Und wenn ja, ist es vielleicht einfach ein weiteres, neoliberales Geschäftsmodell?
Wasel & Haas bezweifeln den ökonomischen Erfolg von Buurtzorg und berechnen, dass die gesamtwirtschaftlichen Kosten in einem vom Buurtzorg-Modell bestimmten Gesundheitswesen eventuell sogar höher wären, allerdings bei einer gleichzeitig höheren Pflegequalität (vgl. Wasel & Haas 2022:167). Es gäbe lediglich eine Verlagerung der Kosten. Eine geringere Gesamtzahl an Pflegestunden wiege die höheren Gehälter bei Buurtzorg wieder aus, es gebe medizinische Follow-Up-Kosten, die nicht in die Rechnung aufgenommen würden und die Effizienz der Arbeitsweise sowie die ökonomischen Bedingungen der Sozialraumorientierung seien noch nicht ausreichend erforscht (vgl. Wasel & Haas 2019:31; 36f.).
Als weiteren Kritikpunkt bringen Wasel & Haas die Überlegung ins Gespräch, selbststeuernde Unternehmen könnten ein kritikwürdiges neoliberales Arbeitsmodell darstellen, vor allem mit Bezug auf den Imperativ der Kundenorientierung, Arbeitszeitflexibilisierung und die Leistungs- und Erfolgsorientierung (Wasel & Haas 2019:169). Sicher wäre es wichtig, ein selbstorganisiertes Unternehmen vor allem an menschenrechtlichen Maßstäben zu messen und die Mitarbeiterzufriedenheit und -gesundheit als ebenso wichtig zu betrachten wie die anderen relevanten Faktoren. Hier könnte sich ein Diskurs zum Thema „guter Arbeit“ eröffnen, in dem das Buurtzorg-Modell betrachtet werden könnte. (vgl. Institut DGB-Index Gute Arbeit 2019; Schermuly 2021; I.L.A. Kollektiv 2019).
Die kritische Reflexion ist vielfältig, und viele Kritikpunkte sind hypothetisch und benötigen tiefgreifendere Forschung. Dennoch möchte ich, ausgehend von Beschreibung und Kritik des Buurtzorg-Modells nun die Frage nach Übertragbarkeit auf die Soziale Arbeite kurz andenken.
Anwendbarkeit des Buurtzorg-Modells auf das Betreute Wohnen
In diesem abschließenden Kapitel möchte ich die Anwendbarkeit des Buurtzorg-Modells auf das Betreute Wohnen reflektieren.
Mit Tochterorganisationen, die mit 4500 Beschäftigten in über 500 Teams Haushaltshilfen, Pflegeheime und ambulante Wohnbetreuung anbieten, hat Buurtzorg bereits breite Erfahrungen im Bereich der Wohn- und Heimbetreuung (vgl. Bernstein et al. 2022:20). Auch Buurtzorg Deutschland war in kleinstem Rahmen im Betreuten Wohnen aktiv (vgl. Stadter 2021:00:12:59).
Leider ist die Anwendung des Buurtzorg-Modells im Betreuten Wohnen nicht zugänglich dokumentiert und es gibt keine Literatur, die sich mit der Frage der Übertragbarkeit auf die Eingliederungshilfe oder die Soziale Arbeit beschäftigt. Auch wäre eine detaillierte Analyse von Organisationen notwendig. So werde ich die Frage nach Übertragbarkeit mit Bezug auf die Inhalte der ersten beiden Kapitel zunächst mit Blick auf Probleme und Risiken sowie auf Stärken und Chancen reflektieren, um dann Empfehlungen für die Implementierung zu skizzieren, die auch auf andere Modelle als das Buurtzorg-Modell verweisen.
Probleme und Risiken
Ein großes Problem bei der Transformation bestehender Organisationen ist der bislang herrschende Führungsstil. So wird eine schwache Führung (vgl. Kap. 1.1) nicht in der Lage sein, die notwendigen Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 2.2) zu schaffen, für die sowohl Vision als auch Durchsetzungsfähigkeit notwendig sind. Eine schwache Führung wird auch immer in Bezug auf die Entstehung informeller Strukturen ein Hindernis sein, da sie diese entstehen lässt, ohne etwas dagegensetzen können. Ein gewisses Element an reflektierter Kontrolle ist also auch in selbstorganisierten Teams und Organisationen notwendig. Eine in manchen Teams und Organisationen beobachtbare übermäßige Kontrolle und starre Regelung von Prozessen macht eine Veränderung hin zu Selbstorganisation schwierig oder unmöglich (vgl. Kap 1.3).
Zentral für den Erfolg von Buurtzorg erscheint mir die Implementierung eines komplexen und nutzerorientierten IT-Systems zur Planung, Evaluation und Information bzw. Fortbildung (vgl. Kap. 2.2 und 2.3). Das Problem eines solchen IT-Systems im Rahmen der Eingliederungshilfe sehe ich in Bezug auf Machbarkeit und Komplexität. Es erscheint mir fraglich, ob ein durchschnittlicher freier Träger das Knowhow sowie die personellen und finanziellen Kapazitäten hat, ein solches System zu entwickeln und zu implementieren. Außerdem gehe ich davon aus, dass die fachliche Komplexität in der Eingliederungshilfe deutlich größer ist und damit eine Standardisierung sehr viel höhere Anforderungen und vermutlich auch negative Begleiterscheinungen haben wird als im Bereich der Hauskrankenpflege. Bei Buurtzorg konnte das IT-System in Verbindung mit dem OHAMA-System eine für die Hauskrankenpflege bis dahin nicht gekannte Interdisziplinarität und Komplexität einführen. In der Eingliederungshilfe gibt es diese bereits, und es wäre eher eine Verschlechterung der Situation zu befürchten. Andererseits wird im Rahmen der BTHG-Umsetzung eine zunehmende Standardisierung gefordert (vgl. Kap 1.1), d. h. trotz Befürchtungen wird hier eine Frage liegen, mit der sich die Eingliederungshilfe in absehbarer Zeit befassen muss und bei der die Standardisierungen, die Buurtzorg erfolgreich anwendet, in eine nützliche Richtung weisen können.
Stärken und Chancen
Fachkräftemangel und mangelnde emotionale Bindung der Mitarbeiter*innen könnten als die größte Herausforderung der Sozialen Arbeit und der Eingliederungshilfe gesehen werden. Außerdem stellt die BTHG-Umsetzung Anforderungen in Bezug auf Flexibilität, Leistungsgestaltung, Qualitätsmanagement und Kostenreduzierung an die Eingliederungshilfe, die momentan kaum absehbar sind (vgl. Kap. 1.1). Hierbei sind klare Parallelen zur Ausgangssituation von Buurtzorg zu erkennen, v.a. in Bezug auf Taylorisierung und die damit einhergehende Entfremdung der Mitarbeiter*innen, mit der Folge wachsender Unzufriedenheit bei Mitarbeiter*innen und Adressat*innen zugleich (vgl. Kap. 1.2 und 1.3). Ohne Buurtzorg als Wunderpille zu verstehen, kann das Modell meines Erachtens Impulse für die Lösung dieser Problematiken geben. Die behutsame Auseinandersetzung mit dem Modell kann also als Chance gesehen werden. Dabei erscheint mir wichtig, die Komplexität des Buurtzorg-Modells zu erfassen und nicht der Gefahr zu erliegen, lediglich auf das Prinzip der Selbstorganisation zu schauen. Stärken sehe ich vor allem bei der Reduzierung von Teams auf max. 12 Mitarbeiter*innen, bei Flexibilisierungen auf allen Ebenen bei gleichzeitiger behutsamer und gut nachvollziehbarer Strukturierung von Arbeitsbeziehungen und Arbeitsabläufen.
Das OMAHA-System als ein wichtiger Teilaspekt des Buurtzorg-Modells wurde bereits in den Kontext des betreuten Wohnens übertragen (vgl. Gapp et al. 2015) und die Erkenntnisse können nutzbar gemacht werden, eventuell als Anregung, die zukünftig gesetzlich vorgegebene ICF-Orientierung in der Hilfeplanung (vgl. Kap. 1.1) im sozialarbeiterischen Kontext praktikabel zu gestalten. Dabei müsste man der Frage nachgehen, wie die IT-basierte Umsetzung des OMAHA-Systems in die Denkweise der ICF übertragen werden kann und wie damit Anforderungen der BTHG-Umsetzung v.a. auch in Bezug auf Evaluation besser als mit anderen Ansätzen erfüllt werden können, ohne den sozialarbeiterischen Handlungsspielraum unnötig einzuschränken oder zu taylorisieren.
Empfehlungen für die Implementierung
Vor allem scheint mir ein behutsamer Umgang bei einer Implementierung wichtig. An vielen Stellen wird eine 1-zu-1-Übertragung nicht möglich sein, und schnelle Erfolge sind nicht sicher. Ähnlich wie im Beispiel von Buurtzorg Deutschland (vgl. Kap. 2.1) wird mit Rückschlägen zu rechnen sein.
Es stellt sich vor allem auch die Frage, ob das Buurtzorg-Modell dogmatisch übertragen werden sollte, oder ob es sinnvoll ist, auf weitere Modelle zu schauen. Wenn Selbstorganisation nicht das Ziel ist, dann könnte Gallups Q12-Ansatz (vgl. Gallup 2022; Buckingham & Coffman 2005) in Verbindung mit Management-Methoden aus dem Feld der Positiven Psychologie (vgl. Blickhan 2018; Seibold 2022) eine Entwicklung in einem traditionellen Managementmodell zu entwickeln, und dabei lediglich auf einzelne Elemente aus dem Buurtzorg-Modell zurückzugreifen, wie der Idee, mit Coaches zu arbeiten, Entscheidungsfindungsprozesse in Teams neu zu gestalten oder die Strukturierung von Arbeitsprozessen auf aktuelle Anforderungen mithilfe der Erfahrungen von Buurtzorg anzupassen (vgl. Kap. 2.2 und 3.2).
Auch im Bereich der Selbstorganisation gibt es Modelle, die in eine ganz andere Richtung gehen als Buurtzorg. Es ist für die Implementierung wichtig zu verstehen, dass Selbstorganisation nicht gleich Selbstorganisation ist. Laloux (2015; 2017) stellt eine Vielzahl an sehr unterschiedlichen Ansätzen vor. Ich habe gute Erfahrungen mit dem soziokratischen Modell gemacht, das in sich auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Umsetzungen ermöglicht (vgl. Strauch & Reijmer 2018; Bockelbrink et al. 2020; Buck & Villines 2017; Rau & Koch-Gonzalez 2018; Robertson 2015). Mein Arbeitgeber arbeitet mit dem auf Soziokratie und anderen Ansätzen basierenden Loop-Approach, der mehr als Methodenkoffer und Prozessbegleitung zu verwenden ist, denn als fixer Ansatz (vgl. Klein et al. 2023).
Vor allem geht es in der Umsetzung um den Lernprozess: aus eigenen Fehlern und denen anderer lernen und sich auf eine faszinierende Reise zu begeben, die nicht nur die Organisation verändert, sondern vor allem die Menschen ihn ihr. Ohne langsame innere Veränderungsprozesse von Individuen wird es auch keine große äußere Veränderung geben (Breidenbach & Rollow 2019:27ff.)
Fazit
In dieser Arbeit habe ich das Buurtzorg-Modell betrachtet und die Frage nach Übertragbarkeit auf die Eingliederungshilfe und das Betreute Wohnen gestellt. Im Schreibprozess ist mir die Komplexität des Buurtzorg-Modells klar geworden: Es geht hier nicht nur um Selbstorganisation, sondern um ein Zusammenspiel vieler unterschiedlicher Faktoren, die weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit bislang ausreichend untersucht wurden.
Bei der Übertragbarkeit auf die Eingliederungshilfe hat mir insbesondere der Vergleich der Ausgangssituation Augen geöffnet: vieles, was Buurtzorg verwirklicht hat, ist in der Eingliederungshilfe alltäglich Realität. Sinnbildlich dafür sehe ich die Tasse Kaffee mit den Adressat*innen. Doch zugleich muss ich die Befürchtung formulieren, dass wir mit den anstehenden Veränderungen der BTHG-Umsetzung neue Rahmenbedingungen schaffen, die den Ausgangsvoraussetzungen bei Buurtzorg gleichen und von Taylorisierung, Entfremdung und Unzufriedenheit geprägt sind. Hier gilt es, Gutes im Bestehende zu bewahren und flexibel auf zukünftige Anforderungen reagieren zu können. Hierzu mag Buurtzorg nicht unbedingt Modell stehen, doch es kann Impulse und Ideen in Verbindung mit vielfältigen anderen Methoden und Ansätzen geben.
Literaturverzeichnis
Auer, Ronny 1999. Chancen und Grenzen der Enthospitalisierung chronisch psychisch kranker Menschen unter besonderer Berücksichtigung der Betreuten Wohngruppen Lüdeckestraße / Lankwitz (Diplomarbeit). Berlin: Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik Alice Salomon.
BAGüS, Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe 2021. Orientierungshilfe zur Durchführung von Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit nach § 128 SGB IX. https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen/ [Stand 2022-01-31].
Bernstein, Ethan S. et al. 2022. Buurtzorg (Case Study). Cambridge MA: Harvard Business School.
Blickhan, Daniela 2018. Positive Psychologie. Ein Handbuch für die Praxis. 2. Auflage Paderborn: Junfermann.
Bockelbrink, Bernhard, Priest, James & David, Liliana 2020. Soziokratie 3.0 - Ein Praxisleitfaden. Sociocracy 3.0. https://sociocracy30.org/guide/ [Stand 2022-03-30].
Breidenbach, Joana & Rollow, Bettina 2019. New Work needs Inner Work. Ein Handbuch für Unternehmen auf dem Weg zur Selbstorganisation. 2. Auflage München: Vahlen.
Buck, John & Villines, Sharon 2017. We the People. Consenting to a Deeper Democracy. 2. Auflage Washington DC: Sociocracy.info.
Buckingham, Marcus & Coffman, Curt 2005. Erfolgreiche Führung gegen alle Regeln. Wie sie wertvolle Mitarbeiter gewinnen, halten und fördern. 3. Auflage Frankfurt/Main: Campus.
DIMDI (Hg.) 2005. ICF. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. Bd. 76, Köln: Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.
Fachhochschule Münster 2023. Buurtzorg - Evaluation eines Modellprojekts zur Umsetzung des niederländischen buurtzorg-Modells in Deutschland. https://www.fh-muenster.de/gesundheit/forschung/buurtzorg.php [Stand 2023-06-5].
Forster, Rudolf 1997. Psychiatriereformen zwischen Medikalisierung und Gemeindeorientierung : eine kritische Bilanz / Rudolf Forster. Opladen: Westdeutscher Verlag.
Gallup 2023. Bericht zum Engagement Index Deutschland 2022. https://www.gallup.com/de/472028/bericht-zum-engagement-index-deutschland.aspx [Stand 2023-04-30].
Gallup 2022. Gallup’s Employee Engagement Survey: Ask the Right Questions With the Q12® Survey. https://www.gallup.com/workplace/356063/gallup-q12-employee-engagement-survey.aspx [Stand 2022-12-5].
Gapp, Nicole E. et al. 2015. Feasibility of Using the Omaha System for Assessment to Determine Optimal Living Situation for Persons with Severe and Persistent Mental Illness. Annals of Psychiatry and Mental Health 3, 2, . https://www.jscimedcentral.com/article-pdf/Annals-of-Psychiatry-and-Mental-Health/psychiatry-3-1026.pdf.
Hickmann, Helen & Koneberg, Filiz 2022. Die Berufe mit den aktuell größten Fachkräftelücken. Köln: Institut für Deutsche Wirtschaft.
Hiob, Norman, Penquitt, Ann-Kathrin & Lux, Gerald 2022. Das Buurtzorg-Modell für die häusliche Pflege. In G. Lux & D. Matusiewicz, hg. Pflegemanagement und Innovation in der Pflege, Wie sich Mensch und Maschine sinnvoll ergänzen. Wiesbaden: Springer Gabler, 127–139.
I.L.A. Kollektiv 2019. Das Gute Leben für Alle. Wege in die solidarische Lebensweise. München: Oekom.
Institut DGB-Index Gute Arbeit (Hg.) 2019. DGB Index Gute Arbeit - Report 2019. Arbeiten am Limit - Themenschwerpunkt Arbeitsintensität. Berlin: Institut DGB-Index Gute Arbeit.
Janning, Udo 2022. Buurtzorg - Ende einer Erfolgsgeschichte? Häusliche Pflege 31, 7, 26.
Klein, Sebastian, Hughes, Ben & Fleischmann, Frederik 2023. Der Loop-Approach. Wie Du Deine Organisation von innen heraus transformierst. 2. Auflage Frankfurt am Main: Campus.
Konrad, Michael 2019. Die Assistenzleistung. Anforderungen an die Eingliederungshilfe durch das BTHG. Köln: Psychiatrie Verlag.
KPMG 2016. Netherlands: Buurtzorg empowered nurses focus on patient value. Value walks. Successful habits for improving workforce motivation and productivity 14–15. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/05/value-walks.pdf.
Laloux, Frederic 2014. Reinventing Organizations. A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage of Human Consciousness. Brüssel: Nelson Parker.
Laloux, Frederic 2016. Reinventing Organizations. An Illustrated Invitation to Join the Conversation on Next-Stage Organizations. Brüssel: Nelson Parker.
Laloux, Frederic 2015. Reinventing Organizations. Ein Leitfaden zur Gestaltung sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Vahlen.
Laloux, Frederic 2017. Reinventing Organizations visuell. Ein illustrierter Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit. München: Vahlen.
Martin, Karen S. 2005. The Omaha System. A Key to Practice, Documentation, and Information Management. 2. Auflage Philadelphia: Elsevier Saunders.
Rau, Ted J. & Koch-Gonzalez, Jerry 2018. Many Voices One Song. Shared Power with Sociocracy. Amherst MA: Sociocracy For All.
Robertson, Brian J. 2015. Holacracy. The New Management System for a Rapidly Changing World. New York: Henry Holt.
Rosemann, Matthias 2018. BTHG: Die wichtigsten Neuerungen für die psychiatrische Arbeit. Köln: Psychiatrie-Verlag.
Schäfers, Markus 2020. TiB Teilhabeinstrument Berlin. Teilhabeorientierte Individuelle Bedarfsermittlung. Manual. 2. Auflage Berlin: Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales. https://www.berlin.de/sen/soziales/_assets/besondere-lebenssituationen/menschen-mit-behinderung/eingliederungshilfe-sgb-ix/bedarfsermittlung-tib/tib_manual-preview.pdf [Stand 2022-04-23].
Schermuly, Carsten 2021. New Work - gute Arbeit gestalten. 3. Auflage Freiburg / München / Stuttgart: Haufe.
Schubert, Michael, Schian, Marcus & Viehmeier, Sarah 2016. Das Bundesteilhabegesetz. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz 59, 9, 1053–1059.
Seibold, Sven 2022. Stress, Mobbing und Burn-out. Umgang mit Leistungsdruck — Belastungen im Beruf meistern. 7th Auflage Berlin: Springer.
Seidel, Andreas & Schneider, Sonja 2021. Praxishandbuch ICF-orientierte Bedarfsermittlung. Beratung, Diagnostik und Hilfeplanung in sozialen Berufen. 2. Auflage Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
Stadter, Cordula 2021. Wir sind der Boss! Selbstbestimmt und mit Freude arbeiten [Fernsehsendung]. https://www.zdf.de/gesellschaft/plan-b/plan-b-wir-sind-der-boss-100.html [Stand 2023-04-16].
Stilling, Gwendolyn 2016. Proteste gegen Bundesteilhabegesetz: Paritätischer warnt vor Leistungskürzungen für Menschen mit Behinderung und fordert Überarbeitung des Gesetzentwurfes. https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/proteste-gegen-bundesteilhabegesetz-paritaetischer-warnt-vor-leistungskuerzungen-fuer-menschen-mit-beh/ [Stand 2022-11-13].
Strauch, Barbara & Reijmer, Annewiek 2018. Soziokratie. Kreisstrukturen als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung des Einzelnen. München: Vahlen.
Tamm, Julia 2015. Ambulant Betreutes Wohnen aus der Perspektive Psychiatrieerfahrener. Abschlussbericht eines Kooperationsprojektes der Universität Siegen, der Arbeitsgemeinschaft Gemeindepsychiatrie Rheinland e.V. (AGpR e.V.), dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) und der Eckhard Busch Stiftung. Siegen: Universi.
Vermeer, Astrid & Wenting, Ben 2018a. Coaching des équipes en Autogestion: Comment S’y Prendre? 2. Auflage Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Vermeer, Astrid & Wenting, Ben 2018b. Selbstorganisation, wie sie richtig funktioniert. Houten: Bohn Stafleu von Loghum.
Vermeer, Astrid & Wenting, Ben 2018c. Selbstorganisierte Teams in der Praxis. Houten: Bohn Stafleu von Loghum.
Wasel, Wolfgang & Haas, Hanns-Stephan 2022. Buurtzorg – Revolution oder Restauration eines (neo-liberalen) Arbeitsmodells. NDV – Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und Private Fürsorge e.V. 102, 4, 166–173.
Wasel, Wolfgang & Haas, Hanns-Stephan 2018. Buurtzorg: eine agile Organisation – der Versuch eines sozialwirtschaftlichen Reviews. Teil 1. NDV – Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und Private Fürsorge e.V. 98, 12, 595–602.
Wasel, Wolfgang & Haas, Hanns-Stephan 2019. Buurtzorg: eine agile Organisation – der Versuch eines sozialwirtschaftlichen Reviews. Teil 2. NDV – Nachrichtendienst des Deutschen Vereins für öffentliche und Private Fürsorge e.V. 99, 1, 31–37.