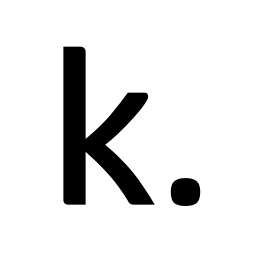Konsent in der Sozialen Arbeit
Wie kann Konsent beispielsweise eingesetzt werden, um Selbstbestimmung und Partizipation zu fördern?
Hier möchte ich eine Methode vorstellen, mit der ich seit 2016 in der Arbeit mit Menschen mit Lernbehinderungen und psychischen Erkrankungen sowohl im Arbeitsbereich als auch in der Bezugsbetreuung im Betreuten Wohnen arbeite: Konsent-Entscheidungsfindung. Das gewählte Fallbeispiel stammt aus der Anfangsphase meiner Arbeit mit Konsent im Kontext Sozialer Arbeit, zu einem Zeitpunkt, an dem ich die Methode eher intuitiv verwendete. Mit dieser Arbeit hole ich den Reflexionsprozess nach und stelle die Frage, welche Rolle Konsent im Rahmen eines personenzentrierten, nicht-direktiven Betreuungsansatzes spielen kann.
Konsent-Entscheidungsfindung ist bislang in Literatur zur Sozialen Arbeit kaum zu finden. Eine Ausnahme findet sich in einer sozialarbeiterischen Einführung zu Restorative Justice, in der Konsent-Entscheidungsfindung als eine in Restorative Justice integrierbare Methode beschrieben wird (siehe Früchtel & Halibrand 2016: 119). Die Methode findet sich vorrangig in Literatur zu Organisationsentwicklung und Management, wo „Konsent“ in der Regel als eine von mehreren Methoden des soziokratischen Managementansatzes beschrieben (vgl. Buck & Villines 2017: 159ff.; Strauch & Reijmer 2018: 33ff.). Seltener wird Konsent auch eigenständig dargestellt, wie zum Beispiel bei Butler & Rothstein (1987). Auch Früchtel & Halibrand (2016:103ff.) stellen Konsent im Rahmen des soziokratischen Ansatzes vor.
Ich werde in der Reflexion der Methode anknüpfen an einen Ansatz aus einer Bezugsdisziplin der Sozialen Arbeit: der Psychologie. Auch wenn Anknüpfungen an Ansätze und Methoden der Sozialen Arbeit wie Partizipation oder Soziale Gruppenarbeit möglich wären, habe ich die Methode ursprünglich als eine handlungsorientierte Konkretisierung des personenzentrierten Ansatzes [1] genutzt, und möchte sie genau aus dieser für mich ursprünglich relevanten Perspektive betrachten, mit einem Fallbeispiel aus dem Jahr 2016 aus einer therapeutischen Gärtnerei, die ich als therapeutischer und operativer Koordinator leitete.
In der Einrichtung hatte ich aufgrund einer Teilnehmerstruktur mit durchweg extremen Verhaltensauffälligkeiten begonnen, den RAID-Ansatz „zur bedingungslos positiven Arbeit mit extremen Verhaltensauffälligkeiten“ (Davies 2000) in Verbindung mit Gewaltfreier Kommunikation (nach Rosenberg 2016) und Konsent-Entscheidungsfindung (nach Butler & Rothstein 1987) zu implementieren. Achtsamkeit (siehe Pfeifer-Schaupp 2010) war ein weiterer verwendeter Ansatz. Die Vermutung liegt nahe, dass die Kombination der Methoden von Bedeutung war, auch wenn ich im Folgenden meinen Blick auf „Konsent“ fokussiere.
Zur Zeit des Fallbeispiels gab es mit Ausnahme von Butler und Rothstein (1987) kaum Literatur zu „Konsent“. Erst in den Folgejahren des Fallbeispiels ist weitere relevante Literatur erschienen (Buck & Villines 2017; Rau & Koch-Gonzalez 2018; Strauch & Reijmer 2018; Bockelbrink u. a. 2020; Klein & Hughes 2019), auf die ich in der rückblickenden Reflexion verwenden werde.
Fallbeispiel
F. ist etwa 50 Jahre alt, mittlere bis starke Intelligenzminderung, stark eingeschränkte Kommunikationskompetenz, in psychotischen Phasen gewaltbereit und gezeichnet von Jahren geschlossener Psychiatrie und Psychopharmaka-Behandlungen ohne psychotherapeutische Begleitung. Zugleich hat er innerhalb der Einrichtung einen Namen als einer, der hart und zuverlässig arbeiten kann. Jahrzehnte im tierlandwirtschaftlichen Bereich des Trägers hat ihn kaum eine andere Person an körperlicher Stärke und Durchhaltevermögen übertreffen können, und die Arbeit dort war für ihn identitäts- und sinnstiftend. Kurz vor dem hier beschriebenen Ereignis entschied F. sich, in den Gärtnereibetrieb wechseln zu wollen. Auch auf Nachfragen gab er keine Gründe an. Sein Wechselwunsch schien aus einem Leidensdruck zu kommen, der er aber nicht benennen wollte oder konnte.
F. ist nun neuer Teilnehmer der Gärtnerei. Wie immer zu Beginn eines Arbeitstages stelle ich auch am Tag des Fallbeispiels vor, welche Aufgaben anstehen. Die Gruppe kann Einwände bringen und wir entscheiden gemeinsam, welche Aufgaben wir angehen werden. Am Tag des Fallbeispiels steht eine große Ernte auf dem Gemüseacker an. Alle sind einverstanden, nur nicht F., der irritiert wirkt und plötzlich laut „Nein“ schreit, ohne eine weitere Begründung zu geben.
Die Gruppe ist über die Heftigkeit seiner Reaktion erschrocken und gewissermaßen erstarrt. Auch ich bin zunächst nicht reaktionsfähig. Nach Klärung weiterer Fragen des Tages und einigen achtsamen Atemzügen spreche ich F. nochmals an und sage: „Du hast gerade ‚Nein‘ zu unserer Arbeit gesagt. Mich interessiert, warum Du ‚Nein‘ gesagt hast und wie wir gemeinsam eine Lösung finden können“. Seine Antwort ist bei Weitem weniger heftig, jedoch immer noch laut, fast ängstlich: „Mein Rücken tut weh“. Ich antworte: „Ah, Dein Rücken tut weh, das ist ein wichtiger Einwand“. F. antwortet jetzt entspannt und freudig: „Ja“. Auch bei den anderen Teilnehmer*innen macht sich Entspannung breit. Das zeigt mir, dass ich ihm helfen konnte, seine Spannung und seinen Einwand zu benennen und es allen in dieser Situation hilft, F.s Motivation zu verstehen.
Im nächsten Schritt überlege ich, wie ich mit der Situation umgehen kann. Da ich an jenem Tag ohne Mitarbeiter*innen bin, kann ich die Gruppe aufgrund von Personalmangel nicht teilen. Das erkläre ich der Gruppe auch so, und sage, dass es mir wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen. Zur Lösung mache ich einen Vorschlag, der sich hauptsächlich an F. richtet: „Mein Vorschlag ist es, dass wir alle zur Ernte gehen, und Du und ich die ganze Zeit zusammenarbeiten. So kannst Du mir sofort Bescheid sagen, wenn Dein Rücken schmerzt. Wir können dann schauen, woran es liegt, dass Dein Rücken bei der Ernte schmerzt. Wir machen gemeinsam ein Experiment, wie Du ohne Schmerzen arbeiten kannst. Hast Du Einwände?“ F. sagt „Nein, keine Einwände, das ist gut“.
Im Verlauf der Arbeit stellen wir in kurzen, reflektierenden Dialogen fest, dass F. schneller arbeiten möchte, als es ihm guttut, dabei emotionale und körperliche Anspannung entwickelt. Auch kommen wir gemeinsam zu dem Ergebnis, dass er eine Tendenz hat, sich übermäßig zu bücken und schwere Kisten zu tragen. In diesen Kurzdialogen lernt er, seine körperliche Grenze in vielen kleinen Situationen zu erkennen und arbeitet an jenem Nachmittag schmerzfrei. So hat er angefangen, die Bedürfnisse seines Körpers zu erkennen und auch seine Grenzen zu verbalisieren.
Im Verlauf der folgenden Wochen und Monate wurde mir aus Gesprächen mit F. klar, dass er ein Leben lang nichts abgelehnt hatte, was von ihm gefordert wurde, tendenziell nicht „Nein“ sagen konnte, und die daraus entstandene Frustration über viele Jahre oder gar Jahrzehnte in gewaltsamen Ausbrüchen gegenüber seiner Umwelt abreagiert hatte. Sein „Nein“ war also in diesem Moment ein großer Durchbruch, ein Zeichen von Mut und Vertrauen. In den Jahren seiner Arbeit in der Tierlandwirtschaft hat er häufig seine körperlichen Grenzen überschritten, fühlte sich ausgebeutet und wehrlos. Für ihn hat mit diesem „Nein“ ein fundamentaler Wandel eingesetzt, der nur der Anfang einer langen Entwicklung zu mehr Selbstsicherheit und Selbstbestimmung war.
Methode
Im Fallbeispiel verwende ich Konsent nicht nach einem starren Prinzip, sondern eher als Haltung unter situationsbedingter Verwendung verschiedener Elemente der Methode im Rahmen von nicht-direktiven Gesprächsmoderationen [3].
Ziele und Funktion
Konsent zielt darauf ab, anstelle von Vorgaben, Forderungen oder Anweisungen Vorschläge zu machen, die nur dann angenommen werden, wenn niemand der Betroffenen relevante Einwände hat (vgl. Strauch & Reijmer 2018:36ff.). In meiner Arbeit ergänzt Konsent einen personenzentrierten, nicht-direktiven Ansatz [4] um den Aspekt einer klar beschriebenen Methodik mit einer unmittelbaren Handlungsorientierung [5]. Anders als in therapeutischen Kontexten ist in der Sozialen Arbeit in vielen Fällen die Handlungsorientierung unumgänglich und leitet in meiner Beobachtung viele Kolleg*innen zu einer direktiven Herangehensweise. Insbesondere im Arbeitsbereich, wie im Fallbeispiel beschrieben, gibt es häufig Sachzwänge, die es schwer machen, nicht-direktiv zu arbeiten und dennoch notwendige Ziele, wie zum Beispiel eine Ernte, zu erreichen. Konsent unterstützt mich, auch in einem hohen Arbeitsdruck einen konsequent nicht-direktiven Ansatz handlungsorientiert zu verfolgen und zugleich nicht vollständig improvisieren zu müssen, sondern ein grobes methodologisches Gerüst für Gespräche im Hinterkopf zu haben, auf das ich im Folgenden genauer eingehen werde.
Ablauf
Der Konsent-Prozess wird in der Regel durch eine Person angestoßen: Dies kann die sozialarbeiterische Fachkraft sein oder auch die Klient*in selbst. Diese Person klärt zunächst „welches Problem gelöst werden [soll]“ oder erläutert eine wahrgenommene „Spannung“ (Klein & Hughes 2019: 137, 69, 92f., 128 ff.) [6].
Basierend auf der Spannung formuliert die Person nun einen Vorschlag [7], die Anwesenden können sich kurz über den Vorschlag unterhalten und Verständnisfragen stellen. Es können auch Ideen zur Verbesserung des Vorschlags angesprochen werden und die Person kann ihren Vorschlag noch einmal überdenken und verändern (vgl. ebd.: 137ff.).
Gibt es keine Einwände zum gemachten Vorschlag, dann ist an dieser Stelle bereits „Konsent“ hergestellt. Gibt es Einwände, dann werden diese jetzt gesammelt und aufgeschrieben. Ein Einwand nach dem anderen wirdjetztn in gemeinsamer Anstrengung in den Vorschlag integriert. Dabei geht es hauptsächlich darum, den Vorschlag besser zu machen als zuvor (vgl. ebd.: 139). Manchmal lassen sich nicht alle Einwände integrieren. Ist es ein kleinerer Einwand, so kann sich oft die Person, die den Einwand gemacht hat, zurücknehmen. Ist es ein größerer Einwand, so können die Anwesenden entscheiden, ob dieser den Vorschlag blockiert. Dabei ist es immer wichtig, dass eine Blockade nicht ein unbegründetes Veto ist, sondern nachvollziehbar begründet werden kann (vgl. Butler & Rothstein 1987: 30f.; Buck & Villines 2017: 301).
Reflexion
In der Reflexion der Methodenanwendung möchte ich zunächst kurz das Fallbeispiel analysieren und die Methodenauswahl begründen, um dann auf Besonderheiten von Konsent in der Sozialen Arbeit einzugehen und kurz verschiedene weitere Anwendungsmöglichkeiten vorzustellen.
Analyse des Fallbeispiels
Das Fallbeispiel steigt mit einem Vorschlag an die Gruppe ein: Ernte auf dem Gemüseacker. Pragmatisch wird hier nicht – wie an dieser Stelle im Konsent-Prozess sonst oft üblich – viel diskutiert: alle haben ein Bild davon, worum es geht. F.s Einwand kommt lautstark und unerwartet. Es braucht zudem Achtsamkeit und Empathie, um ihm den Raum zu geben, seinen Einwand zu benennen, nämlich die Sorge vor Rückenschmerzen. Der ursprüngliche Vorschlag wird nun mit Rücksicht auf F.s Einwand verbessert und ist damit für alle akzeptabel. F. startet mit seinem Einwand eine große, für ihn neue Entwicklung: Er traut sich, „Nein“ zu sagen und seine Bedürfnisse zu formulieren, und er lernt, dass es alternative Handlungsmöglichkeiten gibt, die ihm eine gewaltsame Eskalation ersparen, die er aus seiner Vergangenheit gewöhnt ist.
Im Fallbeispiel folge ich grob den Prinzipien der nicht-direktiven Beratung nach Rogers (2017: 67f.):
Kongruenz / Echtheit: Benennung des Personalmangels und die Unmöglichkeit, die Gruppe zu teilen, also Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit in der Situation;
Bedingungslose Wertschätzung: F.s Bedenken wurden uneingeschränkt ernst genommen, nicht abgewertet oder banalisiert;
Empathie: in den Leidensdruck von F. hineingefühlt und erst einmal so stehen lassen, mit kurzer Paraphrasierung seiner Gedanken, die bei ihm eine sichtbare Entlastung geschaffen hat.
Vor allem wird der Teilnehmer nicht mit „Ratschläge[n], Ermahnungen, Erklärungen und Interpretationen“ (Weinberger 2013: 22) konfrontiert, sondern der Prozess wird in eine lösungsorientierte Richtung gelenkt. Die Nutzung des Konsent-Prozesses ermöglicht eine unmittelbare Handlungsorientierung, die auf den Prinzipien der nicht-direktiven Beratung basiert und sich in diese integriert. Durch Vorschläge seitens der Fachkraft können Handlungsimpulse gesetzt werden, die die Teilnehmer*innen – wenn überhaupt – nicht so in der notwendigen Schnelligkeit setzen würden, und zugleich ist uneingeschränkter Raum für eingebrachte Einwände.
Die Methode und die sich daran anschließenden Handlungsschritte habe ich in jenem Moment intuitiv ausgewählt. Würde ich im Nachhinein die Auswahl begründen, so entlang dieser Gedanken: in der beschriebenen Situation gab es keine Alternative zum Ernteeinsatz. In einem direktiven bzw. autoritären Ansatz hätte ich F. aufgefordert, sich unterzuordnen, ggfs. unter Androhung von Konsequenzen. Das hätte für ihn höchstwahrscheinlich wie eine Drohung gewirkt, kurz- oder langfristig zu einer Störung der Beziehung zu ihm geführt und vermutlich eine ähnliche Gewaltspirale wie anderenorts in der Vergangenheit ausgelöst (siehe auch Davies 2000:4). Das empathische Wahrnehmen seiner Situation und seiner Bedürfnisse (im Sinne von Rosenberg 2016: 21ff.) eröffnet eine neue Handlungsstrategie, die einer Gewaltspirale entgegenwirkt und lösungsorientiert nach alternativen Herangehensweisen sucht. Konsent hilft in dieser Situation, eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Situation zu schaffen. F. wirkte in der beschriebenen Situation und in der Folge sichtbar erleichtert. In Konflikten mit Kolleg*innen in anderen Einrichtungen des Trägers führte seine neue Fähigkeit in den Folgemonaten zunächst zu einem Zuwachs an Konflikten, an deren Höhepunkt F. einen Kollegen als „Sklavenhalter“ bezeichnete. In der gemeinsamen Reflexion der Situation konnte der Kollege verstehen, dass F. eine neue Fähigkeit der entwickelt, und dabei an bestimmten Stellen überreagiert. Diese Überreaktionen sind als wohl bekanntes „rebellisches Stadium“ (Rosenberg 2016: 68) im Prozess der Bewusstwerdung eigener Bedürfnisse zu werten. Sowohl F. als auch die in dieser Phase mit ihm in Konflikte geratenen Kolleg*innen lernten, dass die „rebellische Phase“ ein wichtiger Entwicklungsschritt für F. ist und dass er bald hinauswachsen würde.
Zurückkehrend zum Fallbeispiel als dem Beginn eines größeren Entwicklungsprozesses hat der Rückgriff auf methodisches Handeln in dieser Situation einer impulsiven Reaktion seitens der Fachkraft entgegengewirkt. Die methodische Herangehensweise konnte die Situation deeskalieren, wohingegen eine unreflektierte Antwort auf F.s „Nein“ höchstwahrscheinlich zu einer Eskalation geführt hätte, so zumindest die Erfahrung von Kolleg*innen in der Vergangenheit. Zwar hat die Verhandlung um seine Bedürfnisse Zeit gekostet – doch wie viel mehr Zeit hätte das Übergehen seiner Bedürfnisse mit der Folge einer Gewaltspirale gekostet.
Konsent in der Sozialen Arbeit
Die Verwendung der Methode in der Sozialen Arbeit ist in meiner Erfahrung von ein paar Besonderheiten gekennzeichnet, die ich kurz darstellen möchte.
Ist die Klient*in die Person, die eine Spannung benennen möchte, bedarf dies oft zumindest in der Anfangsphase der empathischen Moderation durch die Fachkraft. Unterstützend dabei sind in meiner Erfahrung die ersten drei Grundschritte der Gewaltfreien Kommunikation: Zunächst die Situation wertneutral beschreiben (Rosenberg 2016: 37ff.), dann Gefühle benennen, die diese Situation ausgelöst haben (ebd.: 47ff.) und letztendlich ein dahinterstehendes Bedürfnis identifizieren (ebd.: 59ff.), um von dort dann eine Bitte zu benennen (ebd.: 75ff.), oder in den Worten der Konsent-Methode hieße die Bitte „Vorschlag“.
Auch im Gespräch im Anschluss an die Formulierung des Vorschlages ist eine ausgeglichene und zurückhaltende Moderation sehr hilfreich. Die Moderation erinnert die Anwesenden ggfs. wiederholt daran, dass das Gespräch nicht wertend, fordernd oder direktiv wird. Hat die Fachkraft den Vorschlag gemacht, so ist oft davon auszugehen, dass die Klient*in in vielen Fällen aufgrund jahrelanger Erfahrung mit direktiv handelnden Fachkräften das Vertrauen finden muss, dass sich im gemachten Vorschlag keine Vorgabe oder Anweisung versteckt, sondern dass es ein Ausgangspunkt für ein Gespräch auf Augenhöhe ist.
Schwere Einwände, die in anderen Kontexten häufig mit der Satzung oder Vision der Gruppe begründet werden, haben in der Sozialen Arbeit eine andere Qualität. Man wird hier vor allem mit Gesetzen oder Verträgen und Absprachen, zu denen auch Betreuungsverträge oder Hilfepläne gehören können, argumentieren. Manchmal sind übliche Umgangsformen oder „gute Sitten“ ein Argument für schwerwiegende Einwände, und in anderen Fällen so etwas Banales wie der Kontostand der Klient*in, der die Umsetzung eines Vorschlages unmöglich macht. Vor allem geht es hier um prinzipienbasierte und transparente Einwände, die im Detail nachvollziehbar und begründet sind.
Die eigenen Vorstellungen und Positionen vor allem bei kleineren Einwänden zurückzunehmen oder bei schweren Einwänden auf gute Argumente zu achten ist für beide Seiten eine Übung, sowohl für Fachkräfte als auch für Klient*innen. Es geht darum, in eine Verhandlung auf Augenhöhe miteinander zu gehen, und das beidseitig: weder die Fachkraft, die bevormundet, noch die Klient*in, die manipulativ handeln muss, um ihre Interessen „durchzudrücken“. Konsent bietet in der Sozialen Arbeit auch einen Raum für einen gemeinsamen Lernprozess von Fachkraft und Klient*innen, selbst wenn nicht stringent angewendet, sondern als Haltung mehr denn als Methode verstanden:
„Each person is capable of creating harmony, resilience, and responsiveness in themselves and in their environment. (…) small changes in your behavior and expectations can make a big difference (…) Function as if consent is the standard decision making” (Villines in Buck & Villines 2017: 239)
Anwendungsbeispiele
Für Konsent in der Sozialen Arbeit gibt es eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten, vor allem im Kontext von Partizipation und Mitbestimmung:
in der Sozialen Gruppenarbeit, in der Begleitung von Mitwirkungsgremien in Behindertenwerkstätten oder betreutem Wohnen sowie in Bewohner*innen-Besprechungen in therapeutischen Wohngemeinschaften;
in Alltagssituationen, in denen die Beteiligten nicht einer Meinung sind; mit etwas Übung durchläuft man dann die Methode unbewusst, beide Seiten geben einander genügend Platz, ihre Bedenken zu äußern und diese auch gegenseitig ernst zu nehmen;
in der Hilfeplanung oder anderen Zielplanungen, in denen sowohl Mitarbeiter*innen als auch Klient*innen Vorschläge machen und Bedenken einbringen [8];
im Konfliktgesprächen, um eine Vereinbarung zu treffen, mit der alle Beteiligten auch wirklich einverstanden sind,
in Teamberatungen zur kollaborativen Entscheidungsfindung;
integriert in sozialarbeiterische Restorative-Justice-Prozesse, wie von Früchtel und Halibrand (2016: 199) beschrieben.
Fazit
Am Fallbeispiel konnte aufgezeigt werden, wie Konsent-Entscheidungsfindung deeskalierend eingesetzt werden kann und zugleich in einem personenzentrierten Betreuungsansatz eine unmittelbare und pragmatische Handlungsorientierung ermöglicht. Konsent als Methode könnte also einen möglichen Weg aufzeigen, wie eine Personenzentrierte Haltung nach Rogers (2017; siehe auch Pörtner 2015) für die Soziale Arbeit tauglich zu machen, gerade weil es den sehr offenen therapeutischen Rahmen, den Rogers empfiehlt, verlässt und klare Schritte vorschlägt, mit denen solide Entscheidungsfindungen mit einer Personenzentrierten Haltung im Kontext der Sozialen Arbeit zielgerichtet umgesetzt werden können. Ein Stück weit kann Konsent ähnlich wie Gewaltfreie Kommunikation eine Konkretisierung von Rogers‘ Personenzentrierung darstellen.
Ein tieferer Blick kann zukünftig sicher in zahlreiche weitere Fallbeispiele geworfen werden, um die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten zu illustrieren und anhand eines Querschnitts unterschiedlicher Fälle zu einer fundierteren Bewertung der Methode zu kommen. Auch wäre sicher eine genauere Betrachtung in der Methode in Verbindung mit Gewaltfreier Kommunikation (Rosenberg 2016) und dem RAID-Ansatz (Davies 2000), mit denen ich den Einsatz von Konsent in der Sozialen Arbeit 2016 begann, von Interesse. Die Synergie dieser Ansätze wissenschaftlich zu bewerten, steht auf jeden Fall auf meiner persönlichen Wunschliste.
Endnoten
[1] Ich beziehe mich in der Begrifflichkeit und Herangehensweise des personenzentrierten, nicht-direktiven Ansatzes auf Rogers (2017) mit Konkretisierung für den sozialarbeiterischen Kontext durch Weinberger (2013).
[2] Ein weiteres Falbeispiel findet sich in Roerick (2022: 3f.)
[3] siehe Endnote 1
[4] siehe Endnote 3
[5] Rogers wollte Personenzentrierung nicht als Methode oder Technik verstanden wissen, was in Wissenschaft und Praxis als nicht unproblematisch rezipiert wird (vgl. Weinberger 2013:41). Mit der Gewaltfreien Kommunikation hat Rosenberg als Schüler von Rogers dessen Werk methodisch umgesetzt (vgl. Rosenberg 2016:15,113,189). In einem ähnlichen Sinne wie die Gewaltfreie Kommunikation fügt sich Konsent als Methode der Sozialen Arbeit in einen personenzentrierten Ansatz ein.
[6] Für die Formulierung einer Spannung in der Arbeit mit Adressatinnen der Sozialen Arbeit sind in meiner Erfahrung die ersten drei Schritte der Gewaltfreien Kommunikation hilfreich, siehe unten im Kapitel „Konsent in der Sozialen Arbeit“.
[7] Dieser Schritt ist analog zu sehen zur Formulierung eines Wunsches in der Gewaltfreien Kommunikation (Rosenberg 2016:75ff.).
[8] „Wenn im Hilfeplangespräch ein bestimmtes sozialpädagogisches Angebot, bei Anwesenheit des Jugendlichen, auch gegen dessen Einverständnis, fachlich begründet durchgesetzt wird, ist das Ausdruck der dortigen Machtverhältnisse. Ob dies (…) perspektivisch eine angemessene und hilfreiche Entscheidung war, wird sich (…) erst später entscheiden“ (Kessl 2021:27)
Literatur
Bockelbrink, Bernhard, Priest, James & David, Liliana 2020. Soziokratie 3.0 - Ein Praxisleitfaden. Sociocracy 3.0. https://sociocracy30.org/guide/ [Stand 2022-03-30].
Buck, John & Villines, Sharon 2017. We the People. Consenting to a Deeper Democracy. 2. Auflage Washington DC: Sociocracy.info.
Butler, C.T. & Rothstein, Amy 1987. On Conflict and Consensus: a handbook on Formal Consensus decisionmaking. Portland, ME: Food Not Bombs Publishing.
Davies, William 2000. The RAID Manual. A relentlessly positive approach in working with extreme behaviour. 3. Auflage Leicester: APT Press.
Früchtel, Frank & Halibrand, Anna-Maria 2016. Restorative Justice. Theorie und Methode für die Soziale Arbeit. Wiesbaden: Springer.
Kessl, Fabian 2021. Macht - noch immer (k)ein Thema Sozialer Arbeit. In B. Kraus & W. Krieger, hg. Macht in der Sozialen Arbeit. Interaktionsverhältnisse zwischen Kontrolle, Partizipation und Freisetzung. Detmold: Jacobs Verlag, 25–40.
Klein, Sebastian & Hughes, Ben 2019. Der Loop Approach. Frankfurt / New York: Campus.
Pfeifer-Schaupp, Ulrich 2010. Achtsamkeit in der Kunst des Nicht-Helfens. Freiburg: Arbor.
Pörtner, Marlis 2015. Ernstnehmen - Zutrauen - Verstehen: personzentrierte Haltung im Umgang mit geistig behinderten und pflegebedürftigen Menschen. 10. Auflage Stuttgart: Klett-Cotta.
Rau, Ted J. & Koch-Gonzalez, Jerry 2018. Many Voices One Song. Shared Power with Sociocracy. Amherst MA: Sociocracy For All.
Roerick, Joel 2022. Konsent. Eine Arbeitshilfe zur kollaborativen Entscheidungsfindung in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. unveröffentlicht. https://1drv.ms/b/s!AhFUroBoPju0gZAxlq9KlydLl9XzZg?e=BoSXGz [Stand 2023-08-06].
Rogers, Carl 2017. Der neue Mensch. 11. Auflage Stuttgart: Klett-Cotta.
Rosenberg, Marshall 2016. Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. 12. Auflage Paderborn: Junfermann.
Strauch, Barbara & Reijmer, Annewiek 2018. Soziokratie. Kreisstrukturen als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung des Einzelnen. München: Vahlen.
Weinberger, Sabine 2013. Klientenzentrierte Gesprächsführung. Lern- und Praxisanleitung für psychosoziale Berufe. 14. Auflage Weinheim / Basel: Beltz Juventa.