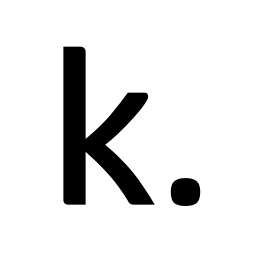Vielfalt
Wie kann eine diversitätsorientierte Soziale Arbeit in der Eingliederungshilfe gestaltet werden, um den komplexen Bedürfnissen von Klient*innen mit Migrationshintergrund und psychischen Erkrankungen gerecht zu werden?
Mit diesem bereits etwas älteren Fallbeispiel werfe ich nach allgemeineren theoretischen Erwägungen den Blick auf einen konkreten Fall aus meiner Arbeit in der Eingliederungshilfe, um daran Fragen der Diversität in der Sozialen Arbeit zu reflektieren. Im Fallbeispiel wird es vor allem um die komplexe Natur von antiislamischen Vorurteilen in der Betreuungsarbeit der Eingliederungshilfe gehen. Ich werde mit der Frage nach Religion als Ressource in Diversity-orientierter Sozialarbeit schließen.
Diversität in der Sozialen Arbeit
Im ersten Teil folgt ein kurzer theoretischer Überblick über die Grundzüge von Diversität in der Sozialen Arbeit, um dann den Bezug zu meinem Arbeitsalltag herzustellen.
Theoretischer Überblick
Den Begriff „Diversity“ definiert Griesehop als „Vielfalt, Verschiedenheit, Heterogenität“ (Griesehop 2011: 17) und nimmt dabei einen positiven Blickwinkel ein: die Zielrichtung der Sozialen Arbeit wäre es demnach, Andersheit nicht abzuwerten, zu leugnen und einem gesellschaftlich definierten Normalitätsbegriff unterzuordnen, sondern ihr mit „Wertschätzung und Anerkennung vor dem Hintergrund einer gesellschaftlichen/sozialen Teilhabe“ (ebd.: 16) zu begegnen. Als Teilbereiche der Diversität nennt Griesehop „Geschlecht, Ethnizität, Kultur, Zugehörigkeit oder aber auch das, was gemeinhin als ‚Behinderung‘ bezeichnet wird.“ (ebd.: 16). Kessl / Plößer stellen fest, dass Differenzen nicht mehr als naturgegeben oder angeboren verstanden würden, sondern als „sozial produziert“ und fordern eine „methodisch-fachliche Neuorientierung“ und einen „fachlich verantworteten Umgang mit Differenz und Andersheit“ (Kessl / Plößer 2010: 7 zitiert nach Griesehop 2011: 15).
Wird Diversität nicht nur als eines unter mehreren Spezialthemen verstanden, sondern zum handlungsleitenden Prinzip, so entstehen neben der Frage nach theoretischen Klärungen innerhalb der Sozialen Arbeit als Disziplin auch konkrete Anforderungen an die Profession:
Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen befähigt werden, soziale Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten aufgrund von Diversity-Merkmalen an erster Stelle überhaupt einmal zu erkennen: „Gesellschaftliche, politische und sozialen Ursachen sowie der Einfluss auf die Lebensbedingungen der Klienten soll erkannt und im professionellen Handeln berücksichtigt werden“ (Griesehop 2011: 17).
Neben einem Blick auf die Gesamtgesellschaft und den Lebensraum der Klient*innen muss auch die eigene Praxis reflektiert werden. So ist zu untersuchen, ob die eigene Einrichtung je nach Zielgruppenstruktur überhaupt eine Offenheit für kulturelle, religiöse oder sexuelle Diversität hat und ob die Personalstruktur diese Offenheit auch reflektiert, zum Beispiel durch interkulturelle Kompetenzen oder Gender-Vielfalt unter den Mitarbeiter*innen. Auch ist es dabei von Bedeutung, eigene Haltungen und Vorurteile bewusst zu reflektieren. (vgl. Griesehop 2011: 17)
Sozialarbeiterischer Ansätze und Methoden müssen so ausgewählt und eingesetzt werden, dass sie „biographische Erfahrungen, Lebenslagen und Lebensweisen unterschiedlicher sozialer Gruppen adäquat berücksichtig[en]“ und dass auf dieser Grundlage unsere Interventionen „soziale[n] Ungerechtigkeiten, Ausgrenzungen oder Marginalisierungen“ entgegensteuern“ (Griesehop 2011:17) und wir Lebenswelten so verändern, „dass Angehörige aller Minderheiten gleichberechtigt an ihnen teilnehmen können“ (Munsch 2010: 154 zitiert nach Griesehop 2011:17).
Die komplexen Anforderungen im Umgang mit Diversität in der Sozialen Arbeit fasst Griesehop als eine „Querschnittaufgabe“ zusammen, „die mit dem Anliegen verbunden ist, die Vielzahl von Strukturkategorien (z.B. Alter, Geschlecht, Ethnie, sozioökonomischer Status, sexuelle Orientierung) zu berücksichtigen“ (Griesehop 2011: 17).
Der gendergerechten und der migrationsbezogenen Sozialen Arbeit kommen in unserer Gesellschaft eine besonders starke Bedeutung zu. Im Sinne der Intersektionalität betreffen die Fragen dieser beiden Bereiche auch andere Bereiche der Diversität.
Im Kontext der gendergerechten Sozialen Arbeit spielt neben strukturellen Fragen einer grundsätzlichen Gleichstellung im öffentlichen und privaten Leben vor allem auch die Frage der gesellschaftlichen Konstruktion von Geschlechtsidentitäten im Gegensatz zum angeborenen Geschlecht eine Rolle sowie das Verständnis von „Geschlecht als Konfliktkategorie“ in einer lebenslangen Ausdifferenzierung und Aushandlung der eigenen geschlechtlichen Identität (Griesehop 2011:18). Griesehop formuliert als Ziel,
„(…) Geschlechterperspektiven konsequent mitzudenken, die spezifischen Problemlagen und Bedürfnisse geschlechtersensibel zu erfassen, angemessene Hilfsangebote zu gestalten und geschlechterbewusste Ansätze zu berücksichtigen.“ (ebd.: 20)
In einer durch Migration zunehmend geprägten Gesellschaft kommen Fragen und Problemlagen auf, die außerhalb des Erfahrungshorizonts vieler Fachkräfte liegen. Da wäre einerseits die Erfahrung, in einer fremden Kultur zu leben, fern von der Heimat und oft getrennt von Teilen der eigenen Familie. In der Fremde sind Ausgrenzung und Diskriminierung oft eine Alltagserfahrung. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus auch jenseits von Gewaltdelikten können auf Betroffene eine traumatische Wirkung haben, die sich Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft nur schwer vorstellen können. Prekäre wirtschaftliche Situationen und oft auch existenzielle juristische Fragen wie im Falle des Aufenthaltsrechts können Biografien teilweise langfristig prägen.
Die migrationsbezogene Soziale Arbeit hat in Deutschland eine Entwicklungsgeschichte von sog. „Ausländerarbeit“ mit Zielgruppe der Gastarbeiter*innen in den 60er, 70er und 80er Jahren, gefolgt von einer „Interkulturellen Arbeit“, die vor allem Wert auf Kommunikation und Interaktion zwischen der Mehrheits- und den Minderheitskulturen legt, bis zum berufspraktisch ausgerichtete handlungsfeldintegrative Ansatz der „Sozialen Arbeit in der Eingliederungsgesellschaft“ als „migrationsbezogene Inklusionsarbeit“ seit der Jahrtausendwende (Griese 2011: 20). Aktuell liegt der Fokus vor dem Hintergrund hoher Erwerbslosigkeit und Betroffenheit von Armut auf der Integration von Migrant*innen in Schule, Ausbildung und Arbeit (vgl. ebd.: 21).
Einordnung in den Arbeitskontext
Für meine Arbeit mit Erwachsenen mit chronischen psychischen Erkrankungen und Lernbehinderungen in der Eingliederungshilfe nach SGB IX sind primär die Ansätze migrationsbezogener, Behinderten- und Gendergerechter Sozialer Arbeit relevant. Ich möchte dies an der demografischen Struktur unserer Klientel und der Mitarbeiter*innen in einem freien Träger der Eingliederungshilfe verdeutlichen, um dann kurz die Diversity-Orientierung des Teams und des Trägers zu bewerten.
Ein Drittel unserer Klient*innen hat einen Migrationshintergrund, vorwiegend aus der Türkei, aber auch aus dem Libanon, Serbien und Griechenland, und knapp die Hälfte der deutschen Klient*innen äußert regelmäßig ausländerfeindliche Vorstellungen. Mehr als die Hälfte der Klient*innen haben einen Schwerbehindertenausweis aufgrund seelischer und körperlicher Behinderungen oder auch Mehrfachbehinderungen, und eine Klient*in hat trotz eigener seelischer Behinderung behindertenfeindliche Tendenzen; eine Klient*in lebt offen in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, ein Klient spricht häufig von homosexuellen Neigungen, ein weiterer setzt sich immer wieder negierend mit seinen homosexuellen Interessen auseinander, drei weitere Klient*innen sind bekennend homophob, Sexismus ist bei männlichen Klient*innen immer wieder ein Thema, Benachteiligung von weiblichen Klient*innen innerhalb der Gesellschaft kommt selten zur Sprache. Eine Klient*in prostituiert sich regelmäßig, bei zwei weiteren Klient*innen ist Verhütung ein immer wiederkehrendes Thema.
Im Team sind drei homo- und bisexuelle Kolleg*innen, die einerseits immer wieder Objekt von homophoben Anfeindungen durch Klient*innen werden, andererseits aber Teil einer gelebten Vielfalt im Team sind. Das Team ist paritätisch mit Frauen und Männern besetzt. Es gibt keine Kolleg*innen mit Migrationshintergrund, wohl aber einen jüdischen Kollegen, der jedoch seine Identität nicht offen trägt, und einen nicht jüdischen Kollegen, der regelmäßig von Klient*innen antisemitisch beschimpft wird. Zwei Kolleg*innen sind schwerbehindert.
Gender-Diversity wird im Team offen thematisiert und positiv besprochen, bei homophoben Beleidigungen finden schnelle Klärungen statt und es herrscht ansonsten ein offenes Klima in Bezug auf Gender-Diversity. Der Umgang mit rassistischen und antisemitischen Bemerkungen ist ambivalent, und kulturelle Diversität wird kaum thematisiert. Es werden trotz der säkularen Ausrichtung des Trägers christliche Feiertage gemeinschaftlich gefeiert, andere Religionen werden nicht thematisiert. Es ist anzumerken, dass das Leitbild nur indirekt von Diversität spricht, ohne speziell auf spezifischere Diversity-Themen wie Gender oder Migration einzugehen.
Im Leitbild heißt es in diesem Zusammenhang lediglich, dass der Ansatz zur Teilhabe auf dem Konzept der sozialen Inklusion basiert. Diese wird als vollständig umgesetzt betrachtet, wenn jedes Individuum in seiner Einzigartigkeit anerkannt wird und uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben partizipieren kann. Es wird betont, dass dieses Ziel nur erreicht werden kann, wenn Unterstützungsleistungen nicht nur auf den Einzelnen ausgerichtet sind, sondern auch dessen persönliches Umfeld im sozialen Kontext fördern und weiterentwickeln.
Diese Aussage findet sich in der Präambel. Das Leitbild geht nicht in einem eigenen Absatz auf Diversität ein. Ebenso finden keine Schulungen zu Diversity-Themen statt, und vor allem Fragen migrationsbezogener Sozialer Arbeit werden sowohl in Teamsitzungen als auch in Supervisionen ausgeklammert. Im Betreuungsalltag wie auch in der Hilfeplanung finden sich keine proaktiven Hinweise auf Diversity-Themen. Wenn Gender-Themen aufkommen, werden sie mit großer Offenheit besprochen, dann aber auch nicht weiterverfolgt. Damit werden viele Faktoren aus dem Leben der Klient*innen regelmäßig übergangen.
Wenn Vahsen et. al. feststellen, dass es „um die Akzeptanz von Unterschieden, das Aushalten-Können von Differenz, die Erkenntnis der eigenen Einstellungen und (Vor)Urteile“ (zitiert nach Griesehop 2011: 21) gehe, so kann man davon ausgehen, dass in meinem Team viele blinde Flecken sind, die bei einer Thematisierung zu neuen Erkenntnissen führen könnten. Eine bewusst Diversity-bezogene Soziale Arbeit könnte positive Impulse für Veränderungen und Entwicklungen bei unseren Klient*innen geben, vor allem bei jenen mit Migrationshintergründen.
Fallbeispiel und Situationsanalyse
Im Folgenden möchte ich ein Fallbeispiel aus meinem Arbeitsalltag vorstellen, eine für diesen Fall typische Situation unter dem Aspekt der migrationsbezogenen Sozialen Arbeit analysieren, um dann kurz einen Blick auf weitere für diesen Fall relevante Differenzkategorien zu werfen.
Der Fall Omar
Omar (27, Name und wiedererkennbare Inhalte des Falls geändert) ist Kind von Einwanderern aus der Türkei, mit der Diagnose einer chronifizierten psychotischen Schizophrenie und einer mittelstarken Lernbehinderung. Er lebt in einer therapeutischen Wohngemeinschaft (TWG), in der ich seine Bezugsbetreuung übernehme, nachdem alle anderen Kolleg*innen diese ablehnen. Sie fordern eine Kündigung seines Wohn- und Betreuungsplatzes in der TWG aufgrund seiner angeblichen „islamistischen Gewaltbereitschaft“. Meines Erachtens ist diese Feststellung nicht begründbar. Er selbst fühlt sich in der TWG wohl, der Leistungsträger bewilligt regelmäßig die Kostenübernahme für eine Hilfsbedarfsgruppe 12, mit der überdurchschnittlich viel Betreuungszeit zur Verfügung steht, und in einer Helferkonferenz kommen alle Beteiligten überein, dass die TWG für ihn als stützend und entwicklungsfördernd eingeschätzt wird.
In psychotischen Phasen monologisiert Omar lautstark, manchmal schreiend, mit stark religiösem Bezug, der von manchen als „islamistisch“ bewertet wird, gepaart mit plötzlichen Körperbewegungen und einem paradox wirkenden Bedürfnis nach Nähe zu oder Körperkontakt mit Menschen in seiner Nähe. Das Suchen nach körperlicher Nähe und sein unberechenbar wirkendes psychotisches Auftreten bewegt vorwiegend Passant*innen im öffentlichen Raum, die ihn nicht kennen, die Polizei zu informieren. Diese rückt in der Regel sofort mit zwei oder drei Mannschaftswagen an, übermannt und fixiert ihn widerstandslos auf dem Boden. Bei jedem Einsatz dem gleichen Muster folgend, stellt die Polizei anschließend fest, dass es keine objektiven Anhaltspunkte für selbst- oder fremd gefährdendes Verhalten Omars gibt und auch laut Polizeiakte nie gab. So wird er zurück zur TWG begleitet. Omar reflektiert die Polizeieinsätze mit Unverständnis, gibt an, dass er nur habe sagen wollen, „dass ich die Leute nett finde“ und drückt seine Frustration aus, dass „alle Menschen denken, dass ich ein Terrorist wäre, nur weil ich an Gott glaube“ (Gedächtnisprotokoll J.R.).
Situationsanalyse
Am Beispiel des beschriebenen Polizeieinsatzes wird sichtbar, dass Omar in psychotischen Phasen subjektiv von Außenstehenden als gefährlich wahrgenommen wird, ohne dass es einen objektiven Hinweis auf gefährdendes Verhalten gäbe. In Omars eigener Reflexion benennt er eine Frustration, in seiner Religiosität von der Mehrheitsgesellschaft nicht verstanden zu werden. Die im Fallbeispiel beschriebene Situation ist kein Einzelfall, sondern wiederholt sich regelmäßig und ist als ein Kernproblem Omars, das ihm eine positive Entwicklung versperrt, zu verstehen. So möchte ich diese Situation aus der Perspektive der migrationsbezogenen Sozialen Arbeit genauer anschauen.
Was passiert in einer solchen Situation genau? Omar fragt eine Passant*in, ob ihn oder sie umarmen dürfe, kommt dabei gegebenenfalls nah an die Person heran, und akzeptiert ein Nein, fragt höflich und ruhig, ob die angesprochene Person „Allahu Akbar“ sagen könne und schlägt eventuell in die Luft, da er einen in seinen Halluzinationen herumfliegenden Pokémon-Charakter vertreiben möchte. Er ist offensichtlich psychotisch und halluziniert stark, mit seiner Körpergröße von 1,90 Metern und einem Gewicht von 130 kg wirkt er physisch überlegen, und seine psychotischen Referenzen an den Islam oder manchmal gar an Islamismus triggern Vorurteile der Passant*innen. Diese Art der Kontaktaufnahme bringt ihn in regelmäßigen Kontakt mit der Polizei. Nach Angaben von Polizei, Psychiater*innen und Betreuer*innen hat er sich in keiner Situation selbst- oder fremd gefährdend verhalten. Hier passiert etwas in der subjektiven Wahrnehmung der Betrachter*innen, das sich objektiv nicht verifizieren lässt.
Auffällig ist, dass ich sowohl in der TWG als auch bei begleiteten Spaziergängen im Sozialraum beobachten kann, dass Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Erfahrung in interkultureller Arbeit auf seine psychotischen Kontaktaufnahmen gelassen reagieren. Sowohl in der TWG als auch im Sozialraum hat er ein stabiles und wertschätzendes soziales Netzwerk. Die Schwere seiner Erkrankung wird auch hier nicht verkannt. Der große Unterschied ist: Er wird bisweilen mit Empathie und Humor angenommen, in anderen Situationen einfach ignoriert oder die durch sein Verhalten betroffenen Personen verhandeln Grenzen mit ihm, die er respektiert. Sein Verhalten triggert hier, anders als bei durchschnittlichen Deutschen, keine Ängste und Abwehrreaktionen. Aus dieser vergleichenden Beobachtung schließe ich, dass viele Deutschen, die Omar begegnen, seine Krankheitssymptome aufgrund antiislamischer Vorurteile unbewusst als „islamistische Gefahr“ umdeuten. Die Natur dieser vorurteilsbehafteten Umdeutung wird meines Erachtens verdrängt und rationalisiert (für eine genauere Bewertung von Vorbehalten in der Arbeit mit Migrant*innen siehe Rommelspacher 2012: 47 und Benz 2007: 36). Dies führt somit zu einer für Omar nicht hilfreichen Realitätsverschiebung, in der die Wichtigkeit der Religion für seine Lebenswirklichkeit ausschließlich als Bedrohung wahrgenommen wird. Rommelspacher stellt fest, dass die „deutschen Professionellen [damit] (…) Aspekte des Anderen ab[spalten] und wesentliche Teile der Lebenswirklichkeit ihrer KlientInnen [missachten]“ (ebd.: 46).
In Bezug auf eine potenziell stabilisierend wirkende Integration von Religiosität in sein Leben ist zu beobachten, dass er keinen Zugang zu einer regelmäßigen und sich für ihn sicher anfühlenden Religionsausübung hat. Im Kontext seiner Moschee wurde er aufgrund seiner psychischen Erkrankung Exorzismus-Riten unterzogen, die ihn nachhaltig traumatisiert haben. Er meidet seitdem den Kontakt zu Moscheen. Sein Religionsbezug erscheint fragmentarisch, diffuse religiöse Inhalte ohne einen festen Religionsbezug verschwimmen häufig mit psychotischem Erleben. Radikal und fanatisch wirkende Inhalte können von ihm zusammenhangslos in Gespräche eingebracht werden, ohne dass diese seine Haltung bestimmen würden. Er ist durchgängig tolerant und akzeptierend gegenüber den Menschen in seinem Umfeld, egal welcher Herkunft. Aus der Beobachtung seines Verhaltens kann von Radikalisierung hier nicht die Rede sein (zur Definition des Begriffes „Radikalisierung“ siehe Koc 2019: 11 ff.), sondern eher von einer nicht integrierten Religiosität, die sich punktuell mit Wahnvorstellungen vermischt.
Die mutmaßliche und nicht reflektierte Vorurteilsbildung hat jedoch in der Sozialen Arbeit weitreichende Folgen, vor allem in der Gefahr direkter und indirekter Diskriminierung Omars aufgrund seiner Religion und Herkunft. So bekommt Omar innerhalb der TWG keine Unterstützung bei der Religionsausübung, wie sie Angehörige christlicher Konfessionen erfahren. Bestenfalls wird sein Wunsch nach Religiosität ignoriert, schlimmstenfalls scharf verurteilt, anstelle Grenzen bewusst und partnerschaftlich auszuhandeln und vor allem auch eigene Meinungen und Vorurteile sowie die der Mehrheitsgesellschaft zu hinterfragen (vgl. Rommelspacher 2012: 50). Lutz (2016:13) weist in seiner Frage nach der Notwendigkeit von Religionsaffinität Sozialer Arbeit darauf hin, dass Sozialarbeiter*innen „angeblich irrationale Kontexte, das Andere der Vernunft [also die ihnen fremde Religionspraxis; Anm. JR], nicht als vormodern [und schon gar nicht per se als ‚fundamentalistisch‘ oder ‚terroristisch‘; Anm. JR] diskreditieren und sich darüber erheben“ dürfen, sondern dass „Religion als Weltbeziehung“ (ebd.: 32 ff.) und damit „Sinn als Ressource“ (ebd.: 40 ff.) verstanden werden kann. Damit entstehen sozialarbeiterische Handlungsoptionen, die im Fall Omar weitgehend fehlen.
Als Bezugsbetreuer mit einer eigenen Biografie interreligiöser und interkultureller Prägungen gehe ich mit Omar das Thema der Religion bewusst und reflektiert an. Ich verstehe seinen Wunsch nach Religiosität als legitime und wichtige Ressource und finde einen urteilsfreien und unterstützenden Zugang zu seiner Religiosität als hilfreich im Aufbau einer Verbindung zu ihm. Er schafft bereits nach kurzer Zeit, Gefühle und Frustrationen zu äußern und seine Lebenswelt und religiösen Erfahrungen zu reflektieren sowie religiösen Sinn von psychotischem Wahn zu unterscheiden.
Weitere Differenzkategorien
Im Fall Omar ist eine Vielzahl teilweise widersprüchlicher Differenzkategorien zu beobachten, vor allem aus den Blickwinkeln Migrationsspezifischer, Gender- und Behindertengerechter Sozialer Arbeit.
Er ist auf seine Art positiv in die deutsche Gesellschaft sowie in einen kulturell vielfältigen Sozialraum integriert. Vor allem auch durch Heimaufenthalte seit der Kindheit ist er weitgehend unter Deutschen sozialisiert. Das stellt eine Differenz gegenüber seiner Herkunftsfamilie her, die ihn eher als „deutsch“ denn als „türkisch“ bewertet. Andererseits fällt er dem Aussehen nach und in seiner Selbstwahrnehmung unter die Differenzkategorie des „Ausländers“. Hinzu kommt, dass er lediglich eine Daueraufenthaltsgenehmigung und keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, wohinter eine größere und noch ungeklärte Rechtsfrage steht (siehe auch Rommelspacher 2012: 45 zur häufigen Problematik der Ausblendung der ausländerrechtlichen Situation von Klient*innen).
Auch in Bezug auf Genderfragen bewegt Omar sich in einem unklaren Geflecht an Erfahrungen und Wünschen. Er hat eine offene homo-erotische Beziehung zu einem Mitbewohner in der TWG, nimmt jedes Jahr mit Begeisterung am Christopher Street Day teil, äußert regelmäßig den Wunsch nach einer festen Beziehung mit einer muslimisch-traditionellen Frau, ist von Pornos fasziniert und hat einen starken Wunsch nach Geschlechtsverkehr mit einer Frau, lehnt aber die Option einer Sexualbegleitung vehement ab, da „Huren“ im Islam verboten seien. Hier ist also ein weites Feld an Fragestellungen zu erkennen, die einen Einfluss nicht nur auf seine Selbstwahrnehmung, sondern auch auf sein Wohlbefinden haben und damit von sozialarbeiterischer Relevanz sind.
Seine psychiatrische Erstdiagnose mit einer Lernbehinderung als Zweitdiagnose eröffnen ein weiteres Spannungsfeld innerhalb der Differenzkategorie der Behinderung. Aus Angeboten der Behindertenarbeit ist er bislang herausgefallen, da dies nur eine Zweitdiagnose ist. Andererseits sind Psychiater*innen und Psycholog*innen sowie auch die Fachkräfte in der Eingliederungshilfe in der Regel nicht in der Lage, eine Beziehungsebene zu Omar herzustellen, da sie mit seinen intellektuellen und kommunikativen Einschränkungen und auffälligen Entwicklungspsychologischen Defiziten nicht ausreichend Erfahrung haben.
So stelle ich die These auf, dass die Komplexität und Widersprüchlichkeit in seinem Umgang mit diesen Differenzkategorien eine Überwältigung für viele seiner Betreuer*innen darstellen. Eine konsequente methodische Arbeit basierend auf einem Konsens an handlungsleitenden Fragen im Helfernetzwerk wäre eine wichtige Basis für Migrationsgerechte, Gender- und Behindertengerechte Soziale Arbeit im Fall Omar. In langsamen Schritten könnten über die Jahre auch tatsächlich mit ihm zusammen Veränderungsprozesse entwickelt werden.
Fazit
Durch die detaillierte Fallanalyse ist mir die Vielschichtigkeit und Komplexität an Diversity-Problematiken im Fall Omar bewusst geworden. Damit kann ich vor allem auch – zumindest hypothetisch und ohne jedes Werturteil – nachvollziehen, aus welchem Grund viele meiner Kolleg*innen seine Betreuung ablehnen: sie tragen nicht nur als Teil der Mehrheitsgesellschaft Vorurteile in sich, die in der Arbeit unter Umständen hinderlich sind, sondern sie sind vermutlich schlichtweg überfordert. Um mit dieser Überforderung umgehen zu können, scheint mir ein ausgeprägtes Diversity-Bewusstsein im Betreuer-Team essentiell, und zwar zur Reflektion sozialarbeiterischen Handelns und vor allen Dingen zur Entwicklung von Diversity-orientierter Methodenkompetenz. Wie dies konkret in unserem Arbeitszusammenhang aussehen könnte, wird sicher Thema einer zukünftigen Arbeit, auf die ich mich schon jetzt freue.
Des Weiteren sehe ich im Fall Omar die Wichtigkeit, Religion als emotional stabilisierende Ressource zu verstehen (für weitere Ausführungen zu diesem Thema aus der Perspektive der Positiven Psychologie siehe Blickhan 2018) und die Frage nach der Option einer interreligiösen Haltung in der Eingliederungshilfe zu stellen (ein theoretischer Ausgangspunkt solcher Erwägungen könnte Meir 2017 sein). Wichtig für weitere Untersuchungen dieser Art erscheint mir die Frage nach sozialarbeiterischen Methoden und Interventionen, Religiosität als einen Aspekt von Diversity zu verstehen und zu ermöglichen. Zu untersuchen wäre die These, ob ein bewusster sozialarbeiterischer Umgang mit Fragen der Religion über einen längeren Zeitraum, getragen vom gesamten Team, eine Stabilisierung Omars bewirkt hätte.
Literatur
Benz, Wolfgang and Peter Widmann 2007. Langlebige Feindschaften – Vom Nutzen der Vorurteilsforschung für den Umgang mit sozialer Vielfalt. In: Diversity Studies. Grundlagen und disziplinäre Ansätze., hrsg. v. Gertraude Krell, Barbara Riedmüller, Barbara Sieben, and Dagmar Vinz, 35–48. Frankfurt am Main / New York: Campus.
Blickhan, Daniela 2018. Positive Psychologie. Ein Handbuch für die Praxis. 2. Auflage Paderborn: Junfermann.
Griesehop, Hedwig 2011. Allgemeine theoretische Grundlagen und deren Relevanz für das methodische Handeln: Heterogenität und Normativität. In: Struktur und Organisation der Sozialen Arbeit, 15 - 21. PDF-Text-Download von [BASA online].
Koc, Mehmet 2019. Jugendextremismus als Herausforderung der Sozialen Arbeit. Baden-Baden: Tectum Verlag.
Lutz, Ronald 2016. Sinn als Ressource. Thesen zur Religionsaffinität Sozialer Arbeit. In: Sozialarbeit und Religion. Herausforderungen und Antworten, hrsg v. Lutz, Ronald and Doron Kiesel, 10 - 54. Weinheim: Beltz Juventa.
Meir, Ephraim 2017. Becoming Interreligious. Towards a Dialogical Theology from a Jewish Vantage Point. Münster, New York: Waxmann.
Rommelspacher, Birgit 2012. Kulturelle Grenzziehungen in der Sozialarbeit: Doing and undoing differences. In: Diversität und Soziale Ungleichheit. Analytische Zugänge und professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit, hrsg. v. Herbert Effinger, Stefan Borrmann, Silke Birgitta Gahleitner, Michaela Köttig, Björn Kraus, and Sabine Stövesan, 43–55. Opladen, Berlin, Toronto: Budrich.