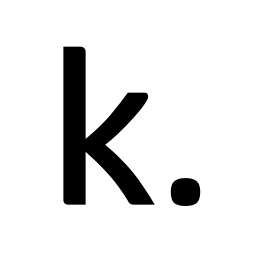Gastfreundschaft
„Wie kann Soziale Arbeit zu einer Kultur der echten Gastfreundschaft beitragen – in einer Gesellschaft, in der Zugehörigkeit oft an Anpassung geknüpft ist?“
Gastfreundschaft in der Sozialen Arbeit – Prinzipien, Kulturen und Praxis
In der Sozialen Arbeit reden wir viel über Teilhabe, Würde und Begegnung auf Augenhöhe. Doch manchmal zeigt sich die echte Haltung in einer einfachen Geste: der Einladung – oder ihrem Ausbleiben. Gastfreundschaft – verstanden nicht nur als private Höflichkeit, sondern als professionelle Grundhaltung – kann zum Prüfstein werden. Sie fragt: Wen lassen wir rein? Wem halten wir die Tür offen? Wem bieten wir einen Platz am (sprichwörtlichen) Tisch ? Gerade in der Eingliederungshilfe und in der Erwachsenenarbeit mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen stellt sich diese Frage akut. Ich möchte das Thema Gastfreundschaft auf mehreren Ebenen beleuchten: als ethisch-politisches Prinzip, als Haltung in Einrichtungen und Teams, im kulturellen Vergleich, in historischer Perspektive und als Quelle konkreter Handlungsperspektiven.
Gastfreundschaft als sozialräumliches Prinzip: Kiezmachen
Im niederländischen Modell des kwartiermaken (deutsch in eigener Übersetzung: Kiezmachen), geprägt von der Soziologin Doortje Kal, ist Gastfreundschaft (gastvrijheid) ein zentrales sozialräumliches Prinzip: ethisch und praktisch zugleich. Dabei bedeutet Gastfreundschaft hier nicht bloß, jemanden in ein bestehendes System einzuladen, sondern erfordert eine aktive Veränderung dieses Systems zugunsten Ausgeschlossener. Es geht also nicht um Integration durch Anpassung an vorgegebene Normen, sondern um Öffnung und strukturellen Umbau des Sozialraums.
Gastfreundschaft ≠ Einseitige Fürsorge: Im Kiezmachen wird Gastfreundschaft nicht als gönnerhafter Top-Down-Akt verstanden („Wir laden euch ein und kümmern uns“), sondern als Haltung der Bereitschaft zur Veränderung eigener Normen, Routinen und Institutionen. Die Einladung erfolgt ohne Bedingungen – sie hält den Raum offen, ohne vom „Gast“ zu erwarten, dass er sich anpasst. Kal (2001) beschreibt dieses Prinzip so:
„Het kwartiermaken is het zoeken naar gastvrijheid in de samenleving voor mensen die vaak worden buitengesloten. […] Gastvrijheid betekent dan niet dat de ander zich moet aanpassen, maar dat wij Raum schaffen für Unterschiedlichkeit.“
(Übersetzung: „Kiezmachen bedeutet, nach Gastfreundschaft in der Gesellschaft für Menschen zu suchen, die oft ausgeschlossen werden. Gastfreundschaft bedeutet dann nicht, dass der Andere sich anpassen muss, sondern dass wir Raum machen für Differenz.“)
Praktische Konsequenz: Kiezmachen zielt darauf ab, den Sozialraum aktiv zu gestalten, sodass auch marginalisierte Menschen selbstverständlichen Platz darin finden. Sozialarbeiter:innen agieren hierbei als „Kiezmacher:innen“ – als Verbündete, die Lücken im Sozialraum sichtbar machen und neue kulturelle Räume eröffnen. Konkret kann dies durch Vermittlung, Dialog, kreative Methoden oder strukturelle Interventionen geschehen. Wichtig ist: Nicht der Mensch muss sich passend machen, die Welt muss sich öffnen. Während in vielen Hilfesystemen Teilhabe immer noch an Anpassungsleistungen geknüpft ist (etwa Therapietreue, „Wohnfähigkeit“ oder Gruppentauglichkeit), fordert das Kiezmachen den Perspektivwechsel: Inklusion durch Öffnung der Gesellschaft statt durch Normierung der Individuen.
Diese politisch-ethische Praxis von Gastfreundschaft hinterfragt bestehende Machtverhältnisse und Kulturstandards nicht nur, sondern transformiert sie aktiv. Integration wird hier als wechselseitiger Prozess verstanden: Die Gesellschaft verändert sich mit, anstatt von den Ausgeschlossenen Assimilation zu verlangen. Gastfreundschaft wird so zu einem demokratischen Prinzip der Raumgabe – dem Schaffen von Orten, an denen Menschen, die als „nicht passend“ gelten, doch dazugehören dürfen.
Gastfreundschaft als Haltung in Einrichtung und Team
Gastfreundschaft ist nicht nur eine Idee, sondern muss sich in sozialen Einrichtungen und Teams als gelebte Willkommenskultur zeigen. Eine solche Kultur drückt sich institutionell etwa in offenen Türen, niedrigschwelligen Angeboten und einer Atmosphäre der Wertschätzung aus. Im beruflichen Alltag sind es oft kleine Gesten, die signalisieren: Du bist willkommen! – Die freundliche Begrüßung in der Morgenrunde, der freie Stuhl im Teamgespräch, die ernstgemeinte Einladung an eine Klientin, die sonst häufig ausgeschlossen wird, weil sie als „schwierig“ gilt. Diese alltäglichen Signale summieren sich zu einer Haltung.
Eine wahrhafte Willkommenskultur bedeutet im Kern: „Du bist willkommen, so wie du bist und dich ausdrückst“. Gastfreundschaft in der Institution heißt, Menschen nicht zuerst durch die Defizit-Brille zu sehen, sondern sie in ihrer Eigenart anzunehmen. Konkret kann das bedeuten, Abläufe und Räume so zu gestalten, dass sich alle ohne Scham und Vorleistung aufgehoben fühlen.
Institutionelle Praxis: Einrichtungen können eine Willkommenskultur verankern, indem sie z.B. schon beim ersten Kontakt eine warme Atmosphäre schaffen. Ein Praxisbeispiel: In einem Pflegeheim wurde das Prinzip „erlebbare Gastfreundschaft“ umgesetzt, indem die Küche neue Bewohner und ihre Angehörigen bereits bei der Aufnahme persönlich kennenlernt, um individuelle Essenswünsche zu berücksichtigen. Übertragen auf die Eingliederungshilfe könnte das heißen, dass z.B. in betreuten Wohnangeboten die Räume mit den Klient:innen personalisiert werden, anstatt sterile Einheitlichkeit vorzuschreiben – oder dass Besucher*innen jederzeit unkompliziert empfangen werden können, ohne bürokratische Hürden.
Teamkultur: Gastfreundschaft als Haltung betrifft auch den Umgang im Team und mit neuen Kolleg:innen. Ein gastfreundliches Team zeichnet sich dadurch aus, dass neue oder „anders denkende“ Mitglieder aktiv eingebunden werden. Statt Konkurrenz und Ausgrenzung herrscht ein Klima, in dem Verschiedenheit als Bereicherung gesehen wird. So wird Kollegialität relational statt nur funktional : Der „schwierige“ Kollege ist nicht bloß ein Störfaktor, sondern jemand, dessen Anderssein Teil unserer gemeinsamen Verantwortung ist. Diese innere Haltung im Team strahlt wiederum auf die Arbeit mit den Adressat:innen aus.
Realistisch betrachtet neigen auch Fachkräfte dazu, empathisch näher an den „angenehmen“ Klient:innen zu sein – denen, die dankbar sind, Erfolg zeigen oder ins Konzept passen. Eine echte Willkommenskultur fordert uns heraus, gerade diejenigen einzuladen, die vielleicht laut, fordernd oder verschlossen sind. Hier entscheidet sich die Qualität unseres professionellen Handelns: Wen laden wir ein, auch wenn es unbequem wird? Wer bekommt einen zweiten, dritten, zehnten Versuch? Gastfreundschaft im beruflichen Kontext heißt, Türen einen Spalt offen zu lassen, wo andere sie längst zugezogen hätten.
Kulturelle Konzepte: Gastfreundschaft im Vergleich
Gastfreundschaft hat in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedliche Prägungen. In Deutschland spricht man zwar gern von „Gastfreundschaft“, doch oft ist sie hierzulande an Bedingungen geknüpft – an Verdienst, Anpassung oder Nützlichkeit. Fremde müssen in der Regel anklopfen und sich erklären; man lädt eher ein, wen man kennt oder wer sich „benimmt“. Gastfreundschaft wird so zu etwas, das gewährt werden muss, kein spontanes Grundrecht für jeden Fremden. Es ist gewissermaßen eine konditionierte Gastfreundschaft, die den grundlegenden Wert eines fremden Menschen nicht voraussetzt.
Andere Kulturen – insbesondere traditionelle Kulturen des Nahen Ostens – kennen demgegenüber oft eine sehr hohe Wertschätzung für Gäste, selbst (oder gerade) wenn sie Fremde sind. Ein besonders aufschlussreiches Beispiel ist die jüdische Tradition der Hachnasat Orchim (Hebräisch für „Gäste aufnehmen“). Im Judentum gilt Gastfreundschaft als wichtiger ethisch-religiöser Wert. Gäste – auch unbekannte Wanderer – werden eingeladen, ohne Leistungsgrenze oder Gegenerwartung. Allein das Menschsein des Gegenübers ist Grund genug für Aufnahme und Bewirtung. Diese Haltung kann man als unbedingte Gastfreundschaft bezeichnen: eine Gastfreundschaft, die keine Bedingungen an Zugehörigkeit, Dankbarkeit oder Anpassung knüpft.
Der Unterschied lässt sich zuspitzen: Während in einer konditionierten Sichtweise der Fremde erst würdig werden muss, Gast zu sein, geht die unbedingte Gastfreundschaft davon aus, dass der Fremde gerade weil er fremd ist, unsere besondere Zuwendung verdient. Der Philosoph Jacques Derrida hat dies ebenfalls thematisiert, indem er zwischen der begrenzten, regelgeleiteten Gastfreundschaft (mit Erwartungen und Bedingungen) und einer radikalen, absoluten Gastfreundschaft unterschieden hat, die den Anderen vorbehaltlos willkommen heißt. In der Praxis ist Letzteres ein Ideal – aber eines, das Orientierung geben kann.
Die deutsche Kultur ist historisch eher von einer zurückhaltenden, förmlichen Gastlichkeit geprägt: Man ist hilfsbereit und höflich, doch spontane Einladungen an Fremde oder bedingungslose Aufnahme Fremder sind eher ungewöhnlich. In jüngerer Zeit wurde der Begriff Willkommenskultur zwar im Kontext von Geflüchteten populär – was eine Öffnung signalisierte –, jedoch steht dem bisweilen eine tief verwurzelte Skepsis gegenüber dem „Fremden“ entgegen. Die jüdische Tradition hingegen – dazu im übernächsten Abschnitt mehr – speist ihre Gastfreundschaft aus einem jahrtausendealten Gebot, den Fremden gerade wegen seiner Fremdheit zu lieben und aufzunehmen. Diese radikale Inklusion kann als Gegenentwurf zur hier beschriebenen konditionierten Gastfreundschaft gesehen werden.
Historische Dimensionen von Exklusion in Deutschland: Selektive Empathie und Euthanasie
Warum ist es für Deutsche oft so schwer, unbedingte Gastfreundschaft zu leben? Ein Blick auf psychologische Mechanismen und die deutsche Geschichte kann das Verständnis schärfen.
Selektive Empathie: Psychologische Studien zeigen, dass Empathie kein neutrales, gleichmäßig verteiltes Mitgefühl ist – sie ist selektiv. Wir empfinden tendenziell stärker mit Menschen, die uns ähneln oder nahe stehen, und weniger mit jenen, die uns fremd sind. Paul Bloom, Psychologe und Autor des Buches Against Empathy, bringt es pointiert auf den Punkt: „Empathy is biased, pushing us in the direction of parochialism and racism“ – Empathie ist voreingenommen und drängt uns in Richtung Gruppendenken und Vorurteile. Sie ist zudem „kurzsichtig“, fokussiert oft auf Einzelschicksale, während abstrakte oder entfernte Leiden weniger gefühlt werden. Mit anderen Worten: Unser Mitgefühl hat blinde Flecken. Diese In-Group-Bias der Empathie ist menschlich verständlich, kann aber fatale Folgen haben, wenn wir moralische Entscheidungen auf dieses Gefühl gründen. Wird Menschlichkeit an Zugehörigkeit gekoppelt, dann hört unser Mitgefühl schnell an den Grenzen des „Eigenen“ auf. Wer außerhalb unseres Kreises steht – kulturell, sozial oder eben aufgrund einer psychischen Erkrankung – läuft Gefahr, nicht als gleichwertiges Gegenüber wahrgenommen zu werden.
Gastfreundschaft als Gegenmittel: Eine Kultur der Gastfreundschaft könnte man verstehen als bewusste Kultivierung von Empathie für Fremde. Indem wir uns verpflichten, Fremde aufzunehmen und ihnen Gutes zu tun, üben wir uns darin, die Grenzen unseres spontanen Mitgefühls zu weiten. So praktiziert z.B. das Judentum Hachnasat Orchim seit Jahrtausenden als antidot zu tribalistischer Engführung: Der Fremde wird eingeladen, ohne jede Bedingung, schlicht weil er ein Mensch ist – unabhängig davon, ob er „dazugehört“. Dieser Bruch mit der selektiven Empathie-Tribalismus ist radikal: Allein das Menschsein begründet die Einladung.
Deutsche Geschichte der Exklusion: In der deutschen Geschichte – insbesondere im Nationalsozialismus – wurde die gefährliche Kehrseite einer konditionierten „Gastfreundschaft“ bzw. Zugehörigkeitsmoral deutlich. Wer nicht ins Bild der „Volksgemeinschaft“ passte, verlor jeglichen Anspruch auf Empathie und wurde zum Außenseiter, ja zum Feind erklärt. Die NS-Ideologie kannte nur Gastfreundschaft für die „Volksgenossen“ – alle anderen galten als Bedrohung oder Ballast. Besonders brutal traf dies Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Bereits vor der systematischen Vernichtung entwickelte sich ein Klima der Entmenschlichung: Man sprach von „lebensunwertem Leben“ und „Ballastexistenzen“. Diese Einstellungen bahnten den Weg für das berüchtigte NS-Euthanasie-Programm Aktion T4, in dem ab 1939 systematisch tausende behinderte und psychisch kranke Menschen ermordet wurden.
Die Zahlen sind erschütternd: Allein im Rahmen von Aktion T4 wurden in den Jahren 1940/41 zunächst rund 70.000 Anstaltsbewohner durch Gas getötet. Neuere Forschungen haben die Opferzahlen noch nach oben korrigiert – man geht heute von etwa 200.000 in Deutschland und Österreich aus; rechnet man die Morde an psychisch kranken Menschen in den besetzten Gebieten hinzu, sind es insgesamt über 300.000 Männer, Frauen und Kinder, die zwischen 1939 und 1945 dem Krankenmord zum Opfer fielen. Viele von ihnen waren Patienten in Heil- und Pflegeanstalten, ausgeliefert Ärzten und Pflegern, die an ihren Schutzauftrag verraten haben. Diese systematische Exklusion und Vernichtung war nur möglich, weil der Wert dieser Menschen in der vorherrschenden Ideologie vollständig aberkannt war – es gab keine „Gastfreundschaft“ mehr für sie, keine Gastfreundschaft der Gesellschaft im Sinne eines Platzlassens im gemeinsamen Leben. Sie galten nicht mehr als Gäste oder Mitbürger, sondern als störende Fremdkörper in der Volksgemeinschaft.
Ein perfider Mechanismus wurde wirksam: Wer nicht eingeladen wird, wird delegitimiert. Wer delegitimiert ist, kann eliminiert werden. Historisch wuchs aus der konditionierten Zugehörigkeitsmoral ein menschenverachtendes System, das von individuellen Haltungen bis zur industrialisierten Massenvernichtung reichte.
Diese Vergangenheit ist ein drastisches Mahnmal dafür, wohin fehlende Gastfreundschaft – im Sinne von fehlender Anerkennung des Anderen als gleichwertigen Menschen – führen kann. Die exkludierende Kultur der NS-Zeit hatte Vorläufer (etwa die lange Tradition der Heim-Unterbringung und Ausgrenzung „Irrer“ seit dem 19. Jh.) und auch Nachwirkungen (Stigmata in der Nachkriegszeit, Diskussionen um Inklusion bis heute). Umso wichtiger ist die bewusste Gegenkultur der Gastfreundschaft in der heutigen Sozialen Arbeit: Sie stellt sich gegen jede Tendenz, Hilfeberechtigung an Dankbarkeit, Anpassung oder Nützlichkeit zu knüpfen. Sie erinnert uns daran, dass jedes Leben Anrecht hat, eingeladen zu sein.
Gastfreundschaft im Judentum: Bibel, Talmud und gelebte Tradition
Ein tieferer Blick in die jüdische Auffassung von Gastfreundschaft kann inspirieren und lehrreich sein. Gastfreundschaft (Hachnasat Orchim) ist im Judentum nicht nur Folklore, sondern theologisch und ethisch verankert – von den biblischen Erzählungen über die talmudischen Auslegungen, über Midraschim und Chassidische Erzählungen bis in die gelebte Praxis religiöser Juden heute.
Biblisches Vorbild – Abrahams Zelt: Im 1. Buch Mose (Genesis / Bereschit) Kapitel 18 wird erzählt, wie der Stammvater Abraham in der Hitze des Tages vor seinem Zelt sitzt und drei fremde Wanderer erblickt. Ohne Zögern springt der 99-Jährige auf, um die Vorbeiziehenden einzuladen. Die jüdische Tradition betont, dass Abrahams Zelt an drei Seiten offen stand, um Gäste anzulocken. Obwohl Abraham gerade eine Vision G”ttes hatte, brach er das Gespräch mit dem Ewigen ab, um sich ganz der Bewirtung der Fremden zu widmen. Die drei Fremden – so stellt sich heraus – waren in Wahrheit Boten G”ttes (Engel), doch das wusste Abraham nicht. Für ihn galt: Den Gast zu empfangen ist wichtiger als eine Audienz beim Ewigen. Im Talmud wird aus dieser Geschichte der berühmte Satz abgeleitet: „Gastfreundschaft ist größer als das Begrüßen der g”ttlichen Gegenwart” (Babylonischer Talmud, Kapitel Schabbat 127a). Mit anderen Worten: Ein Mensch in Not vor deiner Tür zählt mehr als eine spirituelle Erfahrung.
Dieser drastische Vorrang zeigt den Stellenwert der Gastfreundschaft. Abraham und seine Frau Sarah werden zum Inbegriff der großzügigen Gastgeber. Der Midrasch (rabbinische Auslegung) erzählt, sie hätten sogar einen ganzen Gasthof betrieben, um Reisenden kostenfrei Unterkunft und Essen zu bieten. Abraham wird im mystischen Judentum mit der Eigenschaft der Chesed (Liebe/Güte) identifiziert – Gastfreundschaft ist ein zentraler Ausdruck davon.
Gebot der Fremdenliebe: Neben solchen Narrativen findet sich im Torah-Gesetz direkt das Ethos der Gastfreundschaft gegenüber Fremden. Wiederholt mahnt die hebräische Bibel die Israeliten, den Fremden freundlich zu behandeln: „Darum sollt ihr auch die Fremdlinge lieben; denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägypten“ (5. Buch Mose / Deuteronomium / Dewarim 10,19). Dieses oft wiederholte Motiv – „denn ihr wart Fremde in Ägypten“ – ruft die eigene Erfahrung der Versklavung und Heimatlosigkeit in Erinnerung. Es dient als empathische Begründung: Wer selbst einmal Fremdheit und Ausgrenzung erlebt hat, soll gerade deshalb den Fremden mit Liebe begegnen. In Leviticus (Wajikra) 19,34 heißt es sogar: „Der Fremde, der bei euch wohnt, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn ihr seid Fremde gewesen in Ägypten“. Hier wird die berühmte Nächstenliebe („Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“) ausdrücklich auch auf Fremde erweitert.
Diese Gebote machten Gastfreundschaft zu mehr als einer freiwilligen Tat – sie erhoben sie zu einer moralischen Pflicht in der Gemeinschaft Israels. Der Fremde (Ger) im alten Israel genoss rechtlichen Schutz; ihn zu unterdrücken oder auszunutzen war explizit verboten (z.B. Exodus / Schemot 22,20). Stattdessen sollte man ihn in die eigenen Feste und Ernten mit einbeziehen.
Pe’ah – Gastfreundschaft im Ackerbau: Ein spezielles Beispiel unbedingter Solidarität – ich rechne es zur Gastfreundschaft im weiteren Sinne – ist das biblische Gebot der Pe’ah. Dabei handelt es sich um die Vorschrift, beim Ernten die Ecken des Feldes ungeschnitten zu lassen und liegengebliebene Ähren nicht erneut aufzusammeln, damit Arme und Fremde davon lesen können. „Du sollst deinen Acker nicht bis an den Rand abernten … sondern sollst sie den Armen und Fremden überlassen. Ich bin Adonai, euer G”tt.“ (3. Mose / Levitikus / Wajikra 19,9–10) heißt es dazu. Diese Regel institutionalisiert eine Form von Gastfreundschaft auf Gemeinschaftsebene: Die Schwächsten durften am Segen der Ernte teilhaben, ohne bitten oder sich rechtfertigen zu müssen. Das Feld hatte buchstäblich einen ungenutzten Raum am Rand, der für Fremde und Bedürftige reserviert war – ein schönes Bild dafür, was Gastfreundschaft gesellschaftlich bedeutet: Raum lassen für die, die es brauchen. Pe’ah zeigt, dass Gastfreundschaft nicht immer im eigenen Haus stattfinden muss; sie kann auch heißen, öffentliche Güter und Ressourcen für Fremde zugänglich zu halten.
Talmudische Ethik: Die Rabbinen des Talmud rühmen die Gastfreundschaft in höchsten Tönen. An mehreren Stellen wird sie zu den größten Tugenden gezählt. So heißt es in einem Lehrtext: „Die Gastfreundschaft gegenüber Wanderern ist größer als das morgendliche Aufstehen zum Beten… größer als die Annahme der Göttlichen Gegenwart.“ (Talmud, Traktat Schabbat 127a). In der Mischna Peah 1,1 – welche jene Gebote aufzählt, „deren Frucht der Mensch in dieser Welt genießt, während das Kapital ihm für die kommende Welt erhalten bleibt“ – wird u.a. Hachnasat Orchim genannt. Gastfreundschaft gilt also als eine Tat mit unendlichem Wert, die sowohl im Diesseits als auch im Jenseits belohnt wird. Sie steht dort in einer Reihe mit Taten wie Friedensstiften, Besuch von Kranken und der Beschäftigung mit der Tora.
Im Talmud (Gittin 55b - 56a) gibt es eine Geschichte, die bis heute unter die Haut geht: Ein Mann wird zu einem Fest eingeladen – eigentlich sollte jemand anders eingeladen werden, doch der Fehler fällt erst auf, als er schon da ist. Der Gastgeber hasst ihn, will ihn sofort rauswerfen. Der Mann fleht: Lass mich bleiben, ich zahl mein Essen selbst. Keine Chance. Dann sagt er: Ich zahl das ganze Fest. Trotzdem wird er öffentlich gedemütigt und rausgeworfen – vor den Augen der religiösen Autoritäten, die alle schweigen. Tief verletzt geht er zum römischen Kaiser und zettelt – aus gekränktem Stolz – eine Kette von Ereignissen an, die am Ende zur Zerstörung des Jerusalemer Tempels führen. Die Rabbiner sagen: Nicht wegen Politik wurde der Tempel zerstört, sondern wegen „Sin’at Chinam“ – grundlosem Hass, kalter Ausgrenzung und dem Schweigen derer, die es besser wissen müssten. Eine Geschichte über Verantwortung, über Ehre und Demütigung – und darüber, wie leicht eine Gesellschaft zerreißen kann, wenn Gastfreundschaft und Mitgefühl durch Prinzipienreiterei und Ignoranz ersetzt werden.
Im chassidischen Osteuropa war Gastfreundschaft nicht bloß ein Akt der Höflichkeit – sie war ein Ausdruck von G”ttesnähe. Eine Geschichte, die das auf den Punkt bringt, erzählt von Rabbi Mosche Leib von Sassow, einem der großen chassidischen Lehrer des 18. Jahrhunderts. Eines Abends klopft ein armer Fremder an seine Tür. Der Rebbe öffnet, bittet ihn herein, gibt ihm zu essen, einen Schlafplatz – kein Wort der Prüfung, keine Frage, wer er sei. Erst am nächsten Morgen, als der Mann sich verabschieden will, fragt der Rebbe freundlich nach seinem Namen. Ein Schüler wundert sich: Warum so viel Vertrauen? Mosche Leib antwortet sinngemäß: „Man empfängt einen Gast wie einen König – nicht wie einen Angeklagten.“ Überliefert ist diese Szene in der chassidischen Erzähltradition, etwa bei Martin Buber in Die Erzählungen der Chassidim (1950, Teil: „Osteuropäische Meister“). Die Geschichte lebt weniger von dokumentarischer Genauigkeit als von spiritueller Wahrheit: Gastfreundschaft beginnt nicht mit Kontrolle, sondern mit Würdigung.
Soziale Praxis – Schabbat und offene Häuser: In der gelebten jüdischen Tradition hat Gastfreundschaft einen hohen Stellenwert im Alltag, besonders sichtbar am Schabbat (dem Sabbat, wöchentlichen Ruhetag). Schabbat-Mahlzeiten werden traditionell im Familienkreis gefeiert, doch es gilt als große Mitzwa (gute Tat/ Gebot), Gäste am Schabbat-Tisch zu haben – seien es Freunde, Gemeinde-Mitglieder oder Fremde wie z.B. Neuankömmlinge ohne Familie vor Ort. Viele jüdische Familien und Gemeinden praktizieren bis heute eine offene Einladungskultur am Schabbat: Kein Gast soll einsam bleiben. Synagogengemeinden organisieren oft, dass Besucher oder Bedürftige am Freitagabend und Samstagmittag bei jemandem unterkommen und mitessen können. Ein Sprichwort besagt: „Mehr als der Gastgeber den Gast beschenkt, beschenkt der Gast den Gastgeber.“ – denn Gastfreundschaft wird als spiritueller Gewinn verstanden.
Ein Beispiel aus der jüdischen Liturgie zeigt, wie tief die Idee der Gastfreundschaft verankert ist: Am Pessach-Abend lässt man traditionell eine Tür geöffnet und stellt einen eigenen Becher Wein für den Propheten Elijahu (Elija) bereit – den sogenannten Elijahu-Becher. Dieser symbolische Akt drückt die Hoffnung aus, dass der Prophet in der Nacht erscheinen möge, um die Ankunft des Messias anzukündigen. Doch zugleich ist es auch ein bildstarkes Ritual der Offenheit: ein Zeichen dafür, dass man bereit ist, einem unerwarteten – vielleicht sogar heiligen – Gast die Tür zu öffnen. Selbst wenn niemand tatsächlich eintritt, lehrt dieses Ritual, was es heißt, Raum zu lassen für das Unverfügbare, das Andere, das nicht planbar ist – Gastfreundschaft in ihrer tiefsten Form.
Interessant ist auch die Unterscheidung von Gastfreundschaft als Mitzwa (Gebot) und als Chesed (Liebesdienst). Einige Gelehrte sahen es nicht nur als Pflicht, sondern als eine freiwillige Liebestat, die über das bloße Gebot hinausgeht – quasi eine Kür der Herzensgüte. In jedem Fall aber war klar: Ohne Gastfreundschaft keine wahre Frömmigkeit. Die uralte Erfahrung „Wir waren Fremde“ hat sich kulturell eingeprägt, sodass jüdische Gemeinden über Jahrhunderte für ihre Hilfsbereitschaft und Aufnahmebereitschaft bekannt waren – von der mittelalterlichen Herbergs-Tradition bis zur modernen Praxis, jeden Bedürftigen zuerst zu speisen, bevor man nach seinem Anliegen fragt.
Aktuelle Praxis: In jüdisch-orthodoxen Gemeinden ist es bis heute üblich, Fremde (etwa Reisende am Schabbat) über Gemeinde-Netzwerke unterzubringen. Es gibt den Ausdruck Gemach, eine Abkürzung für Gemilut Chasadim (Erweisen von Liebesgut) – damit werden allerlei ehrenamtliche Einrichtungen bezeichnet, z.B. Suppenküchen, Kleiderkammern, etc., die auf dem Gastfreundschafts- und Nächstenliebegedanken basieren. Die Idee dahinter: Was ich habe, stelle ich bereit für den, der gerade Bedarf hat, ohne große Bürokratie.
Im jüdischen Morgengebet findet sich gleich zu Beginn eine zentrale Lehre aus der Mischna (Pe’a 1:1), die aufzählt, welche Taten dem Menschen „Frucht in dieser Welt und Lohn in der kommenden“ bringen. Neben dem Ehren der Eltern, dem Besuch von Kranken und dem Friedensstiften zwischen Menschen steht dort ausdrücklich auch die Gastfreundschaft (Hachnasat Orchim) – das Aufnehmen von Gästen. Damit wird deutlich: Zwischenmenschliche Fürsorge ist im Judentum nicht nebensächlich, sondern eine spirituelle Praxis auf Augenhöhe mit Gebet und Tora-Studium. Gastfreundschaft ist nicht nur gute Sitte, sondern heiliger Dienst am Anderen.
Zusammengefasst zeichnet sich das jüdische Gastfreundschaftsverständnis durch folgende Aspekte aus:
Religiöse Tiefe: Gastfreundschaft ist nicht nur Nettigkeit, sondern G”ttesdienst. Indem man Gäste empfängt, ahmt man G”tt nach, der alle Menschen erhält.
Erinnerungskultur: Die eigene Erfahrung als Fremdling (historisch: Ägypten) verpflichtet zur Empathie und Großzügigkeit gegenüber Fremden.
Unbedingtheit: Hilfe und Aufnahme werden gewährt, ohne Ansehen der Person – der Fokus liegt auf der Bedürftigkeit, nicht auf „Verdiensten“ des Gastes.
Gemeinschaftsbindung: Gastfreundschaft schafft Beziehungen. Am Schabbat-Tisch oder unterm eigenen Dach entsteht eine soziale Bindung, die Fremde zu Freunden machen kann.
Zumutung und Lohn: Obwohl Gäste Aufnehmen auch Mühe bedeutet, betrachtet man es als Quelle von Segen. „Dein Tisch wird zum Altar“, heißt ein Sprichwort: Wer andere speist, dem wird diese Tat in der kommenden Welt gerechnet.
Diese Prinzipien können inspirierend auf die Soziale Arbeit wirken – besonders dort, wo wir mit Menschen arbeiten, die gesellschaftlich marginalisiert sind.
Handlungsperspektiven: Gastfreundschaft in Beratung, Betreuung und Teamarbeit
Was bedeuten all diese Konzepte nun konkret für die Praxis der Sozialen Arbeit, insbesondere in der Arbeit mit psychisch erkrankten Erwachsenen? Im Folgenden einige Impulse, wie Gastfreundschaft als Haltung und Methode eingebunden werden kann – in Beratung und Therapie, im alltäglichen Betreuungssetting und in der Teamkultur. Wichtig ist: Es geht dabei nicht um naive „Gastfreundlichkeit“ im Sinne von Kaffee und Keksen (obwohl die manchmal auch nicht schaden!), sondern um einen grundlegenden Perspektivwechsel.
1. Beratung und Therapie: In beratenden Settings kann Gastfreundschaft heißen, den Raum so zu gestalten, dass sich Klient:innen als willkommene Gäste fühlen. Das beginnt bei der Atmosphäre: Ist der Wartebereich einladend? Wird jemand, der neu kommt, herzlich begrüßt? Schon kleine Zeichen – ein heißes Getränk anbieten, mit Namen ansprechen, Wartezeiten transparent machen – vermitteln Wertschätzung. Inhaltlich bedeutet eine gastfreundliche Beratungshaltung, dem Gegenüber ohne Vorbehalte zu begegnen. Carl Rogers’ Konzept der unbedingten positiven Wertschätzung lässt grüßen: Der/die Sozialarbeiter:in bringt dem Gegenüber Respekt und Akzeptanz entgegen, ohne dass diese erst „verdient“ werden müssten. Auch wenn Klient:innen durch schwieriges Verhalten auffallen (Aggression, Misstrauen, Rückzug), bleibt die Grundhaltung: “Du hast hier Platz, egal wie du erscheinst.” Gerade in der Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen, die oft Ablehnung und Unverständnis erfahren, ist dies zentral. Praktisch kann es bedeuten, dass man bei Terminversäumnissen oder Regelverstößen nicht sofort die „Tür schließt“, sondern nachfragt, alternative Vereinbarungen trifft und signalisiert: „Sie können wiederkommen, wir finden einen Weg.“ Diese Form von geduldiger Einladung schafft die Basis für Vertrauen. Gastfreundschaft kann auch methodisch eingebunden werden, etwa durch aufsuchende Beratung (Outreach) – man geht auf den Menschen zu, anstatt zu warten, dass er in unsere „Sprechstunde“ kommt. So wird wörtlich der Gaststatus umgedreht: Wir besuchen sie in ihrem Terrain, als Gäste dort, und bauen dadurch Beziehung auf Augenhöhe auf.
2. Alltagspraxis in Betreuung und sozialräumlicher Arbeit: In der täglichen Betreuung – z.B. in Wohngruppen, Tagesstätten oder Begegnungsstätten – lässt sich Gastfreundschaft als Prinzip der Offenheit und Flexibilität verankern. Einige mögliche Ansätze:
Niedrigschwellige Angebote: Schafft Orte, an denen Menschen einfach kommen können, ohne große Formalitäten. Offene Treffpunkte, Cafés, Selbsthilfegruppen mit offenem Einstieg sind wie „offene Türen“ im Sozialraum. Wichtig: Neuankömmlinge freundlich begrüßen, vielleicht durch Peer-Greeter (andere Betroffene heißen Neulinge willkommen).
Rituale der Willkommenheißung: Etablieret in Einrichtungen kleine Rituale, die signalisieren: „Schön, dass du da bist!“ – das kann eine Begrüßungsrunde am Morgen sein, ein Willkommensbuch, in das neue Klient:innen etwas über sich schreiben können, oder ein gemeinsames Mittagessen zur Aufnahme. In der Gemeindepsychiatrie könnte man Patenschaften einführen: Jemand aus der bestehenden Gruppe begleitet den „Neuen“ in der ersten Zeit (analog zum Sponsor in Selbsthilfegruppen).
Individualisierung statt Standardisierung: Wie das Kiezmachen lehrt, sollten die Systeme sich den Menschen anpassen, nicht umgekehrt. PrüftHausordnungen, Zeitpläne und Regeln daraufhin, wo etwas mehr Spielraum für individuelle Bedürfnisse gegeben werden kann. Z.B.: Kann ein Nachtruhe-Zeitfenster statt starrer Uhrzeit vereinbart werden, um Nachtschwärmern entgegenzukommen? Dürfen Räume persönlich gestaltet werden? Gibt es Möglichkeiten, Haustiere zu erlauben (für viele Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen enorm wichtig)? – Solche Flexibilitäten sind Ausdruck von Gastfreundschaft, weil sie zeigen: “Du darfst hier sein, mit deiner Art – wir finden Platz für dich.”
Gemeinsame Mahlzeiten: Nichts symbolisiert Gastfreundschaft so sehr wie das Teilen von Essen. Integriert wo möglich gemeinsame Mahlzeiten in den Alltag - und schließt niemanden aus, die oder der dabei sein möchte! Zum Beispiel könnte in einer betreuten Wohnform ein wöchentlicher Koch- oder Grillabend stattfinden, zu dem auch Nachbarn oder Angehörige eingeladen werden. Bewohner:innen könnten reihum Gastgeber sein – was ihr Selbstwertgefühl stärkt – und Mitarbeiter:innen nehmen die Rolle von Mit-Gästen ein, nicht nur Aufsicht. Solche informellen Gemeinschaftszeiten brechen Hierarchien auf und schaffen eine familiäre Atmosphäre.
Sozialräumliches „Kwartiermaken“: Folgt dem Kiezmachen-Ansatz und sucht aktiv nach Lücken im Kiez, wo Menschen mit psychischer Erkrankung noch nicht willkommen sind. Könnt Ihr z.B. lokale Sportvereine oder Kulturzentren dafür gewinnen, explizit Menschen mit seelischen Behinderungen einzuladen (vielleicht mit einem „Schnuppertag“)? Können Geschäfte sensibilisiert werden, auch Kunden mit Auffälligkeiten tolerant zu behandeln? Hier agieren Fachkräfte als Anwälte der Gastfreundschaft im Sozialraum, indem sie Brücken bauen – etwa durch Öffentlichkeitsarbeit, runde Tische oder kreative Aktionen, die Berührungsängste abbauen.
3. Gastfreundschaft in der Team- und Organisationskultur: Soziale Arbeit kann nur so gastfreundlich sein, wie es die Menschen sind, die sie ausüben. Daher muss der Gedanke der Gastfreundschaft auch im professionellen Selbstverständnis und in der Teamkultur verankert sein. Leitungskräfte können das Thema in Teamsitzungen zur Reflexion stellen: Wie begrüßen wir neue Kolleg:innen und Klient:innen? Wo neigen wir zu Vorbehalten? Gibt es „heimliche Ausschlusskriterien“ (z.B. bevorzugt man die kooperativen Klienten und „vergisst“ die anstrengenden)? Ein Team könnte Leitlinien einer Willkommenskultur gemeinsam erarbeiten – ähnlich einem Leitbild, das im Alltag gelebt wird. Fortbildungen zur Diversity-Kompetenz und gegen selektive Empathie können Mitarbeiter:innen helfen, sich ihrer unbewussten Voreingenommenheiten bewusst zu werden (wie Bloom und andere zeigen).
Auf Organisationsebene lässt sich prüfen, ob Strukturen „gastfreundlich“ sind: Werden z.B. Angehörige als Gäste gesehen (oder als Störer)? Wie leicht finden Außenstehende Zugang zu Informationen und Räumen der Einrichtung? Wird auf Rückmeldungen von Nutzern eingegangen (Beschwerdemanagement als Gästestimme)? Eine wirklich gastfreundliche Organisation hat eine offene Feedback-Kultur und bindet Adressat:innen in die Gestaltung ein – sei es durch Bewohnerbeiräte, Nutzerbeiräte oder regelmäßige Zufriedenheitsbefragungen, bei denen dann auch Taten folgen. So wird aus der symbolischen Einladung echte Partizipation.
Auch innerhalb des Teams gilt es, gastfreundlich miteinander umzugehen: neue Kolleg:innen willkommen zu heißen, unterschiedlichen Arbeitsstilen Raum zu geben und Konflikte nicht eskalieren zu lassen, sondern dialogisch anzugehen. Wenn ein Teammitglied „quer“ erscheint, könnte das Team sich fragen: Haben wir einen Platz für dieses Anderssein oder drängen wir die Person raus? – Ganz im Sinne der früheren Ausführung: Der Anspruch der Gastfreundschaft endet nicht bei unseren Klient:innen, sondern umfasst auch den Umgang im Professionellen. Ein Team, das interne Gastfreundschaft lebt, wird nach außen umso überzeugender offen und einladend agieren.
4. Haltung zeigen – politisch und persönlich: Schließlich bedeutet Gastfreundschaft in der Sozialen Arbeit auch, ethisch Position zu beziehen. Fachkräfte sind Fürsprecher ihrer Klientel in Gesellschaft und Politik. Eine Haltung der Gastfreundschaft macht uns sensibel für exkludierende Tendenzen im „großen Ganzen“ – seien es diskriminierende Gesetze, fehlende Barrierefreiheit oder stigmatisierende Medienberichte. Hier dürfen und sollen Sozialarbeiter:innen ihre Stimme erheben für eine Kultur des Willkommens. Gleichzeitig geht es um die persönliche Haltung jedes Einzelnen im Alltag: Bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen, um einem „Fremden“ entgegenzukommen? Lasse ich mich ein auf die Begegnung mit dem Anderen, auch wenn er mir Angst oder Unbehagen macht? Diese Fragen muss sich jede*r stellen – und ehrlich beantworten.
Fazit: Gastfreundschaft als Prinzip in der Sozialen Arbeit bedeutet letztlich, den Wert jedes Menschen vor aller Leistung und Anpassung anzuerkennen. Es heißt, Räume zu schaffen – physisch, sozial, emotional – in denen Menschen einfach sein dürfen, wie sie sind. Die eingangs beschriebenen Ebenen greifen ineinander: Eine Organisation kann noch so viele Konzepte schreiben – entscheidend ist die gelebte Einladungskultur im Alltag, von jedem Teammitglied verkörpert. Die Geschichte lehrt uns drastisch, wohin es führt, wenn Gastfreundschaft nur den Angepassten gilt. Eine zivilisierte, humanitäre Soziale Arbeit zeigt sich dagegen darin, dass die Schwächsten nicht übersehen werden, dass auch der Widerspruch seinen Platz hat und dass jemand kommt, der fremd ist – und willkommen geheißen wird.
Gastfreundschaft mag keine Lösung für alle systemischen Probleme sein. Aber sie ist ein Kompass: Sie erinnert uns an den Kernauftrag der Sozialen Arbeit, nämlich Partei für die Ausgeschlossenen zu ergreifen und Wege zu bahnen, damit aus Fremden Gäste und aus Gästen irgendwann vielleicht Freunde werden können. In diesem Sinne: Halten wir die Türen offen.
Literatur und Quellen
Kal, D. (2001). Kwartiermaken – werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond (Dissertation). Utrecht. [Zitiert nach Kal, 2002: „Werken aan gastvrijheid, omgaan met strijdigheid“] .
Bloom, P. (2016). Against Empathy: The Case for Rational Compassion. New York: Ecco.
Bloom, P. (2017). Empathy and Its Discontents. Frontiers in Psychology. (Zitat: “Empathy is biased, pushing us in the direction of parochialism and racism”.)
Decety, J. & Cowell, J. M. (2015). Empathy, justice, and moral behavior. AJOB Neuroscience, 6(3), 3–14.
Enzyklopädie des Holocaust (United States Holocaust Memorial Museum) – Artikel Euthanasia Program and Aktion T4. (Opferzahlen Aktion T4: ca. 70.000 bis 300.000) .
5. Buch Mose/Deuteronomium 10,19 ; 3. Mose/Levitikus 19,34 – Gebote zur Liebe des Fremden.
Talmud Bavli (Babylonischer Talmud), Traktat Schabbat 127a und Traktat Sota 14a – Stellen zur Überordnung der Gastfreundschaft und Nachahmung göttlicher Barmherzigkeit .
Chabad.org: Why Is Inviting Guests Such a Mitzvah? (Levi Avtzon) – Schilderung von Abrahams Gastfreundschaft .
Shabbatwithfriends.org (Rabbi D. Gartenberg, 2023): Shabbat Hospitality – Blogpost über Schabbat als Praxisfeld der Gastfreundschaft
Hemel & Schwegel (2014). Willkommenskultur für die Altenpflege: Trautes Heim. Heilberufe – Das Pflegemagazin, 66(6). (Plädoyer für Willkommenskultur in Pflegeheimen, Zitat: „Du bist willkommen, so wie du bist…“).