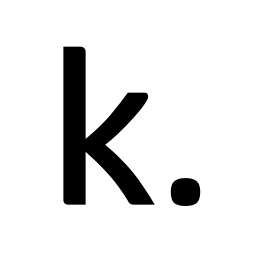Eigensinn
Eigensinn – also eigenwilliges Beharren auf unkonventionellen Lebensmustern – ist ein zentraler Aspekt der Menschenwürde. Klient*innen haben das Recht, ihre Persönlichkeit auch durch scheinbar „widerspenstiges“ Verhalten auszudrücken, solange sie damit keine konkreten Gefahren verursachen. Beispielsweise kann eine Klientin bewusst darauf bestehen, ihre gesammelten Bücherstapel nicht zu ordnen, weil sie diese als kreative Inspirationsquelle empfindet (Socialnet, 2022). Die Soziale Arbeit muss solche individuellen Präferenzen anerkennen, auch wenn sie von gesellschaftlichen Normen abweichen. Eigensinn ist kein Defizit, sondern Ausdruck von Autonomie und muss im Rahmen des Empowerment-Ansatzes respektiert werden (Soziothek, 2023). Gleichzeitig erfordert dies eine sensible Abwägung: Wenn der Eigensinn in selbstschädigendes Verhalten umschlägt – etwa durch das Horten entzündlicher Materialien –, sind behutsame Interventionen geboten, die die Würde der Person wahren (BAG GPV, 2018).
Der Begriff der Menschenwürde hat seine Wurzeln in der antiken Philosophie und der jüdischen Tradition, wo der Mensch als „Ebenbild Gottes“ eine einzigartige Stellung erhielt (Wikipedia, o.J.). Der Philosoph Immanuel Kant prägte im 18. Jahrhundert die bis heute gültige Idee, dass Menschen niemals als Mittel zum Zweck, sondern stets als Selbstzweck behandelt werden müssen (Juraforum, o.J.). Diese Vorstellung spiegelt sich in der deutschen Rechtsprechung wider: Das Bundesverfassungsgericht betont, dass die Würde verletzt wird, wenn Menschen zum bloßen Objekt staatlichen Handelns degradiert werden (BVerfG, zitiert in Juraforum, o.J.). Rechtlich garantiert Art. 1 Abs. 1 GG einen absoluten Achtungsanspruch, der keine Abwägung mit anderen Interessen erlaubt. Das Bundesverfassungsgericht konkretisiert diesen Anspruch durch drei Schutzaspekte: die Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums, die Anerkennung der individuellen Einzigartigkeit und das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe (BVerfG, zitiert in Juraforum, o.J.). Diese Prinzipien verpflichten den Staat nicht nur zum Unterlassen von Würdeverletzungen, sondern auch zum aktiven Schutz vulnerabler Gruppen – etwa durch Betreuungsangebote oder Hilfen bei psychischen Erkrankungen. Im Arbeitsalltag stehen Bezugsbetreuer*innen und rechtliche Betreuer*innen vor der Herausforderung, die Selbstbestimmung von Betreuten zu fördern, ohne deren Wohl zu gefährden.
Ein fiktives Beispiel verdeutlicht die ethischen Dilemmata: Die Wohnung von Herrn M. ist chaotisch und ungepflegt. In zahlreichen Gesprächen erklärt Herr M., dass er sich genau so wohlfühlt. Sein Bezugsbetreuer bietet ihm regelmäßig Unterstützung beim Putzen und Aufräumen an, doch Herr M. lehnt dies vehement ab. Ein Vorgesetzter weist nun den Bezugsbetreuer an, bei Herrn M. tägliche Wohnungskontrollen durchzuführen, weil dessen Unordnung „gegen die Menschenwürde“ sei. Der rechtliche Betreuer des Klienten unterstützt dies und setzt ein Schreiben auf, in dem er die täglichen Wohnungskontrollen anordnet. Juristisch verstößt dies gegen § 1901 BGB, da der Wille des Klienten ignoriert wird (Helbig, 2011). Ethisch problematisch ist die pauschale Herabwürdigung von Herrn M., die dessen Recht auf Individualität missachtet (Menschenrechte Jugendnetz, 2025). Statt Zwang wären freiwillige Hilfen angezeigt – etwa ein Haushaltstraining oder die Vermittlung von Peer-Beratung durch ehemalige Betroffene (BAG GPV, 2018).
Kann Unordnung oder Verwahrlosung als "menschenunwürdig" bezeichnet werden?
Die Frage, ob Unordnung oder Verwahrlosung als „menschenunwürdig“ gelten, lässt sich nicht pauschal beantworten. Entscheidend ist der konkrete Einzelfall. Nur wenn durch die Situation ernsthafte Gesundheitsgefahren entstehen – etwa durch Schimmelbildung, Tierbefall oder eingestürzte Decken –, kann man von einer Würdeverletzung sprechen (Dorgeloh, 2012). In solchen Extremfällen sind Hilfsmaßnahmen nötig, um die betroffene Person zu schützen. Allerdings müssen diese Eingriffe maßvoll sein und die persönlichen Rechte der Betroffenen achten (Lindstedt, 2002, zitiert in Dorgeloh, 2012).
Wichtig ist der Unterschied zwischen Lebensstil und Gefahr: Jeder Mensch hat das Recht, seine Wohnung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, selbst wenn andere dies als „unordentlich“ empfinden (Künzel-Schön, 1999). Erst wenn die Situation die Gesundheit bedroht – etwa durch verdorbenes Essen oder offene Elektrokabel –, darf eingegriffen werden. Viele Betroffene leiden unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder dem Messie-Syndrom, die das Ordnungsverhalten beeinflussen (Dorgeloh, 2012). Statt Zwang sind dann therapeutische Hilfen der richtige Weg.
Das Grundgesetz schützt in Artikel 1 Absatz 1 die Menschenwürde als höchsten Wert. Das bedeutet: Auch ungewöhnliche Lebensformen müssen respektiert werden, solange sie niemanden gefährden (Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1). Sozialarbeiter*innen stehen daher vor der schwierigen Aufgabe, Freiheitsrechte und Schutzpflichten abzuwägen – etwa durch Gespräche über Hilfsangebote, ohne Druck auszuüben (Hannover, o.J.).
Kann ein Bezugsbetreuer eine Klientin dazu bewegen, Ordnung zu halten, mit Bezug auf die Menschenwürde?
Ein Bezugsbetreuer kann eine Klientin dabei unterstützen, Ordnung zu halten – aber nur, wenn dies freiwillig geschieht und ihre Menschenwürde gewahrt bleibt. Dazu nutzt er Methoden wie die motivierende Gesprächsführung, bei der er einfühlsam nachfragt, ohne Druck auszuüben (Gruel, 2012; Wikipedia, o.J.). Ziel ist es, die Klientin dazu zu ermutigen, selbst Lösungen zu finden – etwa durch Fragen wie: „Was könnte Ihnen helfen, sich in Ihrer Wohnung wohler zu fühlen?“ (HAW Hamburg, 2024).
Diese Gesprächstechnik, die ursprünglich von Miller und Rollnick für die Suchttherapie entwickelt wurde (Miller & Rollnick, 2013, zitiert in Gruel, 2012), setzt auf Anerkennung statt Belehrung. Sie stärkt das Selbstvertrauen der Klientin, indem sie kleine Fortschritte lobt und gemeinsam realistische Ziele vereinbart (Living Quarter, o.J.). Beispiel: Statt zu sagen „Sie müssen endlich aufräumen!“, fragt der Betreuer: „Welchen Bereich möchten Sie als Erstes gestalten?“
Eingreifen darf der Bezugsbetreuer nur, wenn konkrete Gefahren drohen – etwa wenn die Klientin aufgrund von Unordnung stürzen könnte oder gesundheitsschädlicher Schimmel in der Wohnung ist (Tag, o.J.). In allen anderen Fällen gilt: Auch ungewöhnliche Lebensstile sind durch die Menschenwürde geschützt.
Kann ein Vorgesetzter den Bezugsbetreuer auffordern, eine Klient*iin mit Bezug auf die Menschenwürde zu mehr Ordnung zu bewegen?
Ein Vorgesetzter darf einen Bezugsbetreuer nur dann auffordern, eine Klientin zu mehr Ordnung zu bewegen, wenn dies fachlich notwendig und rechtlich erlaubt ist. Beispielsweise kann eine Anweisung gerechtfertigt sein, wenn die Wohnung der Klientin gesundheitsgefährdend vermüllt ist und akute Risiken wie Schimmel oder Ungeziefer bestehen (DBSH, 2015; Fachliche Leitlinien Hessen, 2021). Allerdings muss jede Maßnahme die Selbstbestimmung der Klient*in respektieren. Zwang – etwa durch Drohungen oder Strafen – ist unzulässig, da er die Menschenwürde verletzt (EthikDiskurs, o.J.; Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1).
Sozialarbeiterinnen sind nach ihrer Berufsethik verpflichtet, Klientinnen als gleichberechtigte Partnerinnen zu behandeln (DBSH, 2015). Das bedeutet: Der Bezugsbetreuer darf nur Hilfsangebote machen, etwa gemeinsame Aufräumaktionen vorschlagen oder Therapiemöglichkeiten aufzeigen. Er darf die Klientin aber nicht zu etwas zwingen, was gegen ihren Willen geschieht – selbst wenn der Vorgesetzte dies anordnet.
Arbeitsrechtlich gilt: Vorgesetzte dürfen keine Anweisungen geben, die gegen Gesetze oder die Menschenwürde verstoßen (Arbeitsrechtsiegen, o.J.). Wenn eine Bezugsbetreuerin eine Anweisung als unethisch empfindet – zum Beispiel, weil die Klientin dadurch bloßgestellt wird –, kann sie diese verweigern. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Urteil bestätigt, dass Mitarbeiterinnen in solchen Fällen vor Kündigung geschützt sind (Süddeutsche Zeitung, 2015).
Welche Standards an Ordnung/Sauberkeit darf ein Bezugsbetreuer durchsetzen? Wo ist eine Grenze?
Ein Bezugsbetreuer darf keine festen Standards für Ordnung oder Sauberkeit vorschreiben, solange keine konkreten Gefahren vorliegen. Er kann nur aktiv werden, wenn die Situation die Gesundheit oder Sicherheit der Klientin gefährdet. Dazu zählen Gesundheitsrisiken wie Schimmel in der Wohnung oder verdorbene Lebensmittel, Sicherheitsprobleme wie zugestellte Fluchtwege oder herumliegende Kabel sowie akute Selbstgefährdung, etwa wenn die Klientin aufgrund von Unordnung stürzen könnte (DBSH, 2015; Fachliche Leitlinien Hessen, 2021). In allen anderen Fällen hat die Klientin das Recht, ihre Wohnung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten – selbst wenn dies für andere ungewöhnlich erscheint.
Die Aufgabe des Bezugsbetreuers besteht darin, die Klientin durch Gespräche und praktische Hilfen zu unterstützen, ohne Druck auszuüben. Er könnte beispielsweise fragen: „Welche kleinen Schritte könnten Ihnen helfen, sich hier wohler zu fühlen?“ (Becker, 2018; Living Quarter, o.J.). Ziel ist es, die Eigenverantwortung zu stärken, anstatt Lösungen vorzugeben.
Die Grenze liegt dort, wo die Selbstbestimmung der Klientin endet und die Schutzpflicht des Betreuers beginnt. Ein Beispiel: Wenn die Klientin aufgrund von Vermüllung nicht mehr schlafen oder kochen kann, muss der Bezugsbetreuer handeln – aber stets im Dialog und mit Respekt vor ihren Wünschen (Bewo Aachen, 2023).
Was bedeutet Menschenwürde theoretisch/juristisch im Kontext von Sozialer Arbeit und Recht auf Eigensinn/Verwahrlosung?
Menschenwürde bedeutet im Kern: Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben selbst zu gestalten – auch wenn andere dies als „seltsam“ oder „unordentlich“ empfinden. Das Grundgesetz schützt dieses Recht in Artikel 1 als höchsten Wert (Grundgesetz, Art. 1 Abs. 1). In der Sozialen Arbeit heißt das konkret: Klient*innen dürfen ihre Wohnung vermüllen oder ungewöhnliche Gewohnheiten haben, solange sie damit niemanden gefährden und selbst nicht in Not geraten (Menschenrechte Jugendnetz, 2025; Soziothek, 2023).
Verwahrlosung kann ein Ausdruck von Freiheit sein. Beispiel: Eine Klientin sammelt alte Zeitungen, weil sie ihnen emotionalen Halt gibt. Sozialarbeiter*innen müssen solche Lebensweisen respektieren, selbst wenn sie sie nicht nachvollziehen können (Socialnet, 2022). Erst wenn konkrete Risiken entstehen – etwa Brandgefahr durch stapelweise Zeitungen –, ist behutsames Eingreifen nötig.
Vermüllung mit Seuchenrisiko: Rechtsrahmen und Abgrenzungskriterien
Der Begriff „Vermüllung mit Seuchenrisiko“ bezeichnet extreme Verwahrlosungszustände, die durch konkrete Gesundheitsgefahren für die Allgemeinheit gekennzeichnet sind. Rechtsgrundlage ist primär das Infektionsschutzgesetz (IfSG) (§ 18 Abs. 1 IfSG), das staatliche Eingriffe zur Abwehr von Epidemien regelt. Ein solches Risiko liegt vor, wenn die Wohnsituation Krankheitserreger verbreitet oder gesundheitsschädliche Umwelteinflüsse schafft – etwa durch verrottende Abfälle, massiven Ungezieferbefall (z. B. Ratten, Kakerlaken) oder faulige Gase aus Schimmel und Abwasseraustritt.
Ein Beispiel: Eine Wohnung, in der meterhohe Müllberge Fluchtwege blockieren und Rattennester beherbergen, stellt ein Seuchenrisiko dar, da sich Erreger wie Salmonellen oder Leptospiren auf Nachbarhaushalte ausbreiten können. In solchen Fällen darf das Gesundheitsamt nach § 16 IfSG eine Zwangsräumung anordnen, sofern ein richterlicher Beschluss vorliegt (Ausnahme: akute Gefahr, z. B. Choleraverdacht). Abzugrenzen ist dies von „harmlosen“ Unordnungszuständen: Solange eine Wohnung keine Fremdgefährdung darstellt – etwa bei chaotischer, aber hygienisch unbedenklicher Büchersammlung –, ist sie durch die Selbstbestimmungsgarantie (Art. 2 Abs. 1 GG) geschützt. Erst bei nachweisbarer Gefahr (z. B. Schimmelsporen in der Raumluft, die Asthma auslösen) greifen staatliche Schutzpflichten.
Die Abwägung zwischen dem Schutz der individuellen Autonomie und staatlichen Interventionen bei Seuchenrisiken folgt strengen rechtlichen Kriterien. Zunächst muss das Gesundheitsrisiko durch fachlich fundierte Gutachten nachgewiesen werden – etwa durch hygienische Messungen der Raumluft oder Laboranalysen von Schimmelproben. Zweitens muss die gewählte Maßnahme verhältnismäßig sein: So ist beispielsweise eine professionelle Reinigung der Wohnung stets vor einer vollständigen Räumung zu prüfen, um den Eingriff in die Privatsphäre zu minimieren. Drittens sind Betroffene gemäß § 28 IfSG aktiv am Verfahren zu beteiligen, etwa durch Anhörungen oder die Möglichkeit, eigene Vorschläge zur Gefahrenabwehr einzubringen. Dies gewährleistet, dass staatliches Handeln nicht nur effektiv, sondern auch respektvoll gegenüber der Menschenwürde erfolgt.
Die Aufgabe der Sozialen Arbeit ist es, eine Balance zu finden zwischen Respekt vor Eigenheiten und Schutz vor Gefahren. Dazu gehört, Klient*innen dabei zu unterstützen, ihre Stärken zu nutzen, statt sie zu bevormunden (Empowerment.de, 2022). Ein Bezugsbetreuer könnte etwa fragen: „Was brauchen Sie, um sich in Ihrer Wohnung sicher zu fühlen?“ statt einfach Aufräumdienste anzuordnen.
Die Verbindung von Eigensinn und Menschenwürde verdeutlicht, dass das Recht auf selbstbestimmte Lebensführung auch dann gilt, wenn sie gesellschaftlichen Normen widerspricht. Der Schutz dieser Individualität ist kein Luxus, sondern eine rechtliche und ethische Pflicht, die im Grundgesetz (Art. 1 Abs. 1) und der Berufsethik der Sozialen Arbeit verankert ist (DBSH, 2015; Soziothek, 2023). Das Beispiel von Herrn M., dessen Unordnung pauschal als „unzumutbar“ bewertet wird, zeigt, wie schnell Eigensinn in eine Herabwürdigung münden kann, wenn Fachkräfte äußeren Druckvorstellungen nachgeben.
Doch gerade im Spannungsfeld von Fürsorge und Autonomie muss die Soziale Arbeit als Advokatin der Menschenwürde agieren: Sie schützt das Recht auf „chaotische“ Lebensentwürfe, solange keine konkreten Gefahren wie Gesundheitsrisiken vorliegen (Dorgeloh, 2012; Fachliche Leitlinien Hessen, 2021). Gleichzeitig bedeutet dies nicht, Betroffene sich selbst zu überlassen. Vielmehr liegt die Kunst darin, durch Empowerment-Ansätze wie motivierende Gesprächsführung (Miller & Rollnick, 2013) Räume zu schaffen, in denen Klientinnen eigene Lösungen entwickeln – sei es das kreative Chaos einer Büchersammlerin oder ein selbstgewählter Aufräumplan.
Letztlich gilt: Eigensinn ist kein Hindernis, sondern Ausdruck von Selbstwirksamkeit. Die Würde des Menschen verlangt, diese Eigenheit nicht als Störfaktor, sondern als unveräußerliches Merkmal der Persönlichkeit zu achten – auch dann, wenn sie Verwahrlosung ähnelt. Sozialarbeitende tragen hier die Verantwortung, strukturelle Machtmechanismen zu hinterfragen und Klientinnen als Expert*innen ihres Lebens zu empowern, statt sie an fremde Ordnungsvorstellungen anzupassen (Socialnet, 2022; BAG GPV, 2018).
Quellen
Arbeitsrechtsiegen. (o.J.). Unwirksame Ausübung des Direktionsrechts des Arbeitgebers bei geringwertigerer Tätigkeit. Verfügbar unter: https://www.arbeitsrechtsiegen.de/artikel/unwirksame-ausuebung-des-direktionsrecht-des-arbeitgebers-bei-geringwertigerer-taetigkeit/
Becker, M. (2018). Das Konzept des Empowerment in der Sozialen Arbeit und seine Bedeutung für die Praxis [PDF]. Bachelorarbeit. Verfügbar unter: https://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_thesis_0000001872/dbhsnb_derivate_0000002615/Bachelorarbeit-Becker-2018.pdf
Bewo Aachen. (2023). Ressourcenorientierte Betreuung in der Praxis. Verfügbar unter: https://www.bewo-aachen.de/ressourcenorientierte-arbeit
DBSH. (2015). Berufsethik des DBSH. Verfügbar unter: https://www.dbsh.de/profession/berufsethik.html
Dorgeloh, E. (2012). Vortrag Verwahrlosung [PDF]. Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft Sozialpsychiatrischer Dienste NRW. Recklinghausen. Verfügbar unter: https://www.lag-sozialpsychiatrische-dienste-nrw.de/images/pdf/vortrag%20verwahrlosung%2020120420.pdf
Empowerment.de. (2022). Grundlagentext Empowerment (Einführung). Verfügbar unter: https://www.empowerment.de/grundlagen-einfuehrung/
EthikDiskurs. (o.J.). Ethik in der Sozialen Arbeit – Erklärung der Prinzipien [PDF]. Verfügbar unter: https://www.ethikdiskurs.de/fileadmin/user_upload/ethikdiskurs/Themen/Berufsethik/Soziale_Arbeit/Ethik_in_der_Sozialen_Arbeit.pdf
Fachliche Leitlinien der Betreuungs- und Pflegeaufsicht in Hessen. (2021). Fachliche Leitlinien der sozialen Betreuung [PDF]. Verfügbar unter: https://hlfgp.hessen.de/sites/hlfgp.hessen.de/files/2023-01/fachliche_leitlinien_der_sozialen_betreuung_2021_es_ba.pdf
Forum Wirtschaftsethik. (o.J.). Personalführung und Menschenwürde. Verfügbar unter: https://www.forum-wirtschaftsethik.de/personalfuehrung-und-menschenwuerde/
Gruel, K. (2012). Motivierende Gesprächsführung – eine Methode im Rahmen der psychosozialen Arbeit [PDF]. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades: Diplom-Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin (FH). Verfügbar unter: https://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_derivate_0000001206/Diplomarbeit-Gruel-2012.pdf
H-Team e.V. (o.J.). Das Messie-Syndrom - Wenn Chaos das Leben regiert. Verfügbar unter: https://www.h-team-ev.de/das-messie-syndrom-wenn-chaos-das-leben-regiert/
Hannover. (o.J.). Grenzen bei Verwahrlosung im häuslichen Umfeld [PDF]. Verfügbar unter: https://www.hannover.de/content/download/673588/file/Brosch%C3%BCre_Verwahrlosung.pdf
HAW Hamburg. (2024). Aktivierende und motivierende Gesprächsführung. Verfügbar unter: https://www.haw-hamburg.de/weiterbildung/soziale-arbeit/aktivierende-motivierende-gespraechsfuehrung/
Juraforum. (o.J.). Menschenwürde – Definition und Bedeutung. https://www.juraforum.de/lexikon/menschenwuerde
Künzel-Schön, H. (1999). Verwahrlosung bei älteren Menschen. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, 32(4), 253–258.
Lindstedt, L. (2002). Wohnungs-Verwahrlosung. Soziale Arbeit, 51(10), 342–346.
Living Quarter. (o.J.). Empowerment und Selbstbestimmung fördern: Strategien und Erfolge. Verfügbar unter: https://www.livingquarter.de/empowerment-und-selbstbestimmung-foerdern-strategien-erfolge/
Menschenrechte Jugendnetz. (2025). Menschenwürde. Verfügbar unter: https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/glossar/menschenwuerde
Messie-Syndrom. (o.J.). In Wikipedia. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Messie-Syndrom
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motivierende Gesprächsführung: Hilfe zur Veränderung (3. Aufl.). Lambertus.
Socialnet. (2022). Empowerment | socialnet Lexikon. Verfügbar unter: https://www.socialnet.de/lexikon/Empowerment
Soziothek. (2023). Das Verständnis der Menschenwürde in der Sozialen Arbeit. Verfügbar unter: https://www.soziothek.ch/das-verstaendnis-der-menschenwuerde-in-der-sozialen-arbeit
Süddeutsche Zeitung. (2015, November 15). Unethische Anweisungen - Mitgefangen, mitgehangen. Verfügbar unter: https://www.sueddeutsche.de/karriere/unethische-anweisungen-mitgefangen-mitgehangen-1.2732753
Tag, B. (o.J.). Gedankensplitter zur Menschenwürde [PDF]. Verfügbar unter: https://www.kas.de/documents/252038/253252/Menschenwuerde_tag.pdf/6841298d-f84e-f02d-73ef-d42c336236c6
Wikipedia. (o.J.). Menschenwürde. https://de.wikipedia.org/wiki/Menschenw%C3%BCrde
Wikipedia. (o.J.). Motivierende Gesprächsführung. Verfügbar unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Motivierende_Gespr%C3%A4chsf%C3%BChrung