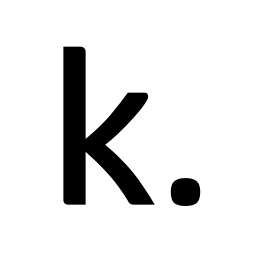Positive Verhaltensunterstützung
Kann der Ansatz “Positive Verhaltensunterstützung” für die Arbeit mit Menschen mit seelischen Behinderungen und starken Verhaltensauffälligkeiten genutzt werden?
Die Positive Verhaltensunterstützung ist ein vielversprechender Ansatz in der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit seelischer Behinderung und starken Verhaltensauffälligkeiten. Besonders für Personen, die oft als "Systemsprenger" oder "schwer zu erreichen" bezeichnet werden, bietet dieses Konzept wertvolle Möglichkeiten.
Die Positive Verhaltensunterstützung, ursprünglich für Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt, lässt sich auch auf Menschen mit seelischen Behinderungen oder chronischen psychischen Erkrankungen ohne geistige Behinderung anwenden. Der ganzheitliche und ressourcenorientierte Ansatz eignet sich besonders gut für diese Zielgruppe, da er die individuellen Stärken und Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt und nicht nur auf die Reduzierung von Symptomen abzielt.
Hauptziele der Positiven Verhaltensunterstützung
Das übergeordnete Ziel der Positiven Verhaltensunterstützung ist die Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Person bei gleichzeitiger Reduzierung problematischen Verhaltens. Es geht dabei nicht nur um die Beseitigung störender Verhaltensweisen, sondern um eine ganzheitliche Unterstützung und den Aufbau neuer, positiver Verhaltensweisen.
Georg Theunissen, ein führender Experte auf diesem Gebiet, beschreibt die Ziele folgendermaßen: "Die positive Verhaltensunterstützung bemisst ihren Erfolg an einer hohen Lebenszufriedenheit der unterstützten Person und an der Erlangung von mehr Autonomie und Lebensqualität."
Das funktionale Assessment als Ausgangspunkt
Ein zentraler Bestandteil der Positiven Verhaltensunterstützung ist das funktionale Assessment. Dieser erste Schritt dient dazu, die Funktion und den Zweck des problematischen Verhaltens zu verstehen. Theunissen erklärt: "Die positive Verhaltensunterstützung beginnt mit einem sog. funktionalem Assessment, das nach dem 'Wozu' des Verhaltens sucht."
Bei diesem Assessment werden verschiedene Methoden eingesetzt:
Beobachtungen in verschiedenen Situationen
Gespräche mit der betroffenen Person (wenn möglich)
Befragungen von Angehörigen und Betreuungspersonen
Analyse von Dokumentationen und Vorfallsberichten
Ziel ist es, Muster zu erkennen und zu verstehen, welche Bedürfnisse oder Botschaften hinter dem Verhalten stehen könnten.
Bei der Anwendung auf Menschen mit seelischen Behinderungen ist es wichtig, das funktionale Assessment an die spezifischen Herausforderungen dieser Gruppe anzupassen. Dabei werden nicht nur die sichtbaren Verhaltensweisen, sondern auch die zugrunde liegenden emotionalen und kognitiven Prozesse berücksichtigt. Die Analyse der Funktion des Verhaltens kann beispielsweise Aufschluss darüber geben, wie bestimmte Verhaltensweisen zur Bewältigung von Ängsten, depressiven Zuständen oder anderen psychischen Symptomen dienen. Auf dieser Basis können dann individuelle Unterstützungsstrategien entwickelt werden, die alternative Bewältigungsmechanismen fördern und die Lebensqualität verbessern.
Entwicklung eines individuellen Unterstützungsplans
Basierend auf den Erkenntnissen des funktionalen Assessments wird ein maßgeschneiderter Unterstützungsplan entwickelt. Dieser Plan umfasst verschiedene Maßnahmen und Strategien:
Anpassung der Umgebung und Rahmenbedingungen
Oft können schon kleine Veränderungen im Umfeld helfen, Stress zu reduzieren und problematisches Verhalten zu vermeiden. Dies kann beinhalten:
Anpassung der Raumgestaltung (z.B. Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten)
Überprüfung und ggf. Anpassung von Tagesabläufen und Routinen
Reduzierung von Reizüberflutung
Schaffung von vorhersehbaren Strukturen
Erweiterung des Verhaltens- und Handlungsrepertoires
Ein wichtiger Aspekt ist es, der Person neue Fähigkeiten und alternative Verhaltensweisen zu vermitteln. Theunissen betont: "Die positive Verhaltensunterstützung vermittelt die Fähigkeiten, die notwendig sind, um in der Allgemeinheit funktionieren zu können und um Stress- und Angstniveaus zu senken."
Dies kann folgende Aktivitäten umfassen:
Training sozialer Kompetenzen
Erlernen von Problemlösestrategien
Übungen zur Emotionsregulation
Vermittlung von Entspannungstechniken
Förderung der Kommunikation
Da Verhaltensauffälligkeiten oft eine Form der Kommunikation darstellen, ist die Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten ein zentraler Punkt. Dies kann beinhalten:
Einführung von unterstützter Kommunikation (z.B. Bildkarten, Gebärden)
Training von verbaler und nonverbaler Kommunikation
Förderung des Ausdrucks von Bedürfnissen und Gefühlen
Positive Verstärkung erwünschten Verhaltens
Anstatt sich nur auf die Reduzierung problematischen Verhaltens zu konzentrieren, legt die Positive Verhaltensunterstützung großen Wert auf die Förderung und Belohnung positiven Verhaltens. Dies kann umfassen:
Entwicklung eines individuellen Verstärkersystems
Regelmäßiges Feedback und Lob für erwünschtes Verhalten
Schaffung von Erfolgserlebnissen
Persönlichkeits- und lebensstilunterstützende Maßnahmen
Die Positive Verhaltensunterstützung betrachtet die gesamte Lebenssituation und persönliche Entwicklung der Person. Dazu gehören:
Unterstützung bei der Entwicklung von Interessen und Hobbys
Förderung von Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
Einbeziehung in Entscheidungsprozesse
Unterstützung bei der beruflichen Orientierung oder Tagesstrukturierung
Krisenmanagement
Für akute Situationen werden Strategien entwickelt, um sicher und deeskalierend zu reagieren. Dies beinhaltet:
Erstellung eines individuellen Krisenplans
Training von Deeskalationstechniken für Betreuungspersonen
Entwicklung von Frühwarnsystemen zur Erkennung von Krisen
Praktische Umsetzung
In der praktischen Arbeit ist es wichtig, die Maßnahmen flexibel und individuell anzupassen. Gerade bei Menschen, die als "Systemsprenger" gelten, braucht es oft kreative Lösungen und viel Geduld. Eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Betreuern und Klienten ist dabei von entscheidender Bedeutung.
Konkrete Aktivitäten können beispielsweise sein:
Regelmäßige Einzelgespräche zur Reflexion und Zielplanung
Erarbeitung und regelmäßige Überprüfung eines individuellen Krisenplans
Einführung und Anpassung von Tages- und Wochenstrukturen
Angebot von Entspannungstechniken wie Progressive Muskelentspannung oder Achtsamkeitsübungen
Bereitstellung kreativer Ausdrucksmöglichkeiten wie Malen, Musik oder Bewegung
Training sozialer Kompetenzen in Kleingruppen oder Rollenspielen
Unterstützung bei der Freizeitgestaltung und Erschließung neuer Interessen
Zusammenarbeit mit Angehörigen und anderen Bezugspersonen zur Schaffung eines unterstützenden Netzwerks
Schulung der Mitarbeitenden
Ein wichtiger Aspekt der Positiven Verhaltensunterstützung ist die Schulung und kontinuierliche Unterstützung der Mitarbeitenden in der Eingliederungshilfe. Sie müssen lernen, Verhaltensauffälligkeiten nicht als persönlichen Angriff zu verstehen, sondern als Kommunikationsversuch.
Theunissen schreibt dazu: "Es ist nicht länger akzeptabel, ein bestimmtes störendes Verhalten mit dem Argument zu entschuldigen, dass die Person 'schon immer so war, das liegt in der Familie'. Auch wurde erkannt, dass Problemverhalten eine Form der Kommunikation ist – das Verhalten dient einem Zweck und sendet eine klare Botschaft an andere."
Die Schulung der Mitarbeitenden kann folgende Aspekte umfassen:
Vermittlung der Grundprinzipien der Positiven Verhaltensunterstützung
Training in Deeskalationstechniken und Krisenintervention
Schulung in Methoden des funktionalen Assessments
Reflexion eigener Haltungen und Vorurteile
Supervision und kollegiale Beratung
Herausforderungen und Chancen
Die Umsetzung der Positiven Verhaltensunterstützung erfordert oft einen Perspektivwechsel und viel Geduld. Gerade bei Menschen, die schon lange als "schwierig" gelten, braucht es Zeit, um Vertrauen aufzubauen und neue Verhaltensweisen zu etablieren.
Herausforderungen können sein:
Hoher zeitlicher und personeller Aufwand, besonders in der Anfangsphase
Notwendigkeit einer kontinuierlichen Anpassung und Überprüfung der Maßnahmen
Mögliche Rückschläge und Krisen, die Frustration auslösen können
Koordination verschiedener Beteiligter (Klient, Angehörige, verschiedene Fachkräfte)
Chancen der Positiven Verhaltensunterstützung sind:
Nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Personen
Reduzierung von Zwangsmaßnahmen und freiheitsentziehenden Maßnahmen
Entlastung der Betreuungspersonen durch weniger Krisensituationen
Förderung von Selbstbestimmung und Teilhabe
Fazit und Ausblick
Insgesamt bietet die Positive Verhaltensunterstützung einen umfassenden und wertschätzenden Ansatz für die Arbeit mit Menschen mit herausforderndem Verhalten. Sie zielt darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern und echte Teilhabe zu ermöglichen.
Theunissen fasst zusammen: "Die positive Verhaltensunterstützung befasst sich mit den Faktoren, die das Verhalten von Autisten beeinflussen, und stellt eine aus vielen Elementen bestehende Methode dar, um die Probleme anzugehen, alternative Reaktionen aufzuzeigen und neue Fähigkeiten zu vermitteln."
Durch die konsequente Anwendung dieses Ansatzes können auch Menschen, die bisher als "Systemsprenger" galten, neue Wege finden, ihre Bedürfnisse auszudrücken und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Positive Verhaltensunterstützung ist damit ein wichtiger Baustein für eine inklusive Gesellschaft, die alle Menschen mit ihren individuellen Stärken und Herausforderungen willkommen heißt.
Ein besonderer Fokus bei der Anwendung der Positiven Verhaltensunterstützung auf Menschen mit seelischen Behinderungen liegt auf der Stärkung der Selbstwirksamkeit und der Förderung von Resilienz. Durch die Einbeziehung der Betroffenen in den gesamten Prozess - von der Analyse bis zur Entwicklung und Umsetzung von Unterstützungsmaßnahmen - wird ihre Autonomie gestärkt. Gleichzeitig werden soziale Ressourcen aktiviert und ein unterstützendes Umfeld geschaffen, das zur Stabilisierung beiträgt. Die Kombination aus individueller Verhaltensunterstützung und systemischem Ansatz kann dazu beitragen, Rückfälle zu reduzieren und eine nachhaltige Verbesserung der psychischen Gesundheit zu erreichen.
Die Weiterentwicklung und Verbreitung dieses Ansatzes in der Eingliederungshilfe kann dazu beitragen, die Versorgung und Unterstützung von Menschen mit seelischen Behinderungen und Verhaltensauffälligkeiten nachhaltig zu verbessern und ihnen ein selbstbestimmteres Leben zu ermöglichen.
Literatur
Theunissen, G. (2023). Positive Verhaltensunterstützung: Eine Arbeitshilfe für den pädagogischen Umgang mit herausforderndem Verhalten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten, sogenannter geistiger oder mehrfacher Behinderung (7. aktualisierte Auflage). Bundesvereinigung Lebenshilfe.