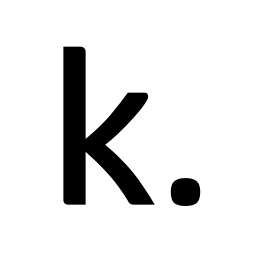Soziale Diagnostik
Braucht die Soziale Arbeit eine eigene Diagnostik?
In unserem Berufsalltag begegnen wir komplexen Lebenssituationen, die sich nicht in einfache Schubladen stecken lassen. Eine spezifische soziale Diagnostik kann uns dabei helfen, diese Komplexität zu erfassen und zu strukturieren. Sie ermöglicht es uns, die vielfältigen Einflussfaktoren auf das Leben unserer Klientinnen zu berücksichtigen - von persönlichen Ressourcen über soziale Netzwerke bis hin zu gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
Dabei geht es nicht darum, Menschen zu kategorisieren oder zu etikettieren, sondern vielmehr darum, ein ganzheitliches Verständnis ihrer Situation zu entwickeln. Soziale Diagnostik kann uns helfen, den Blick für die Stärken und Potenziale unserer Klientinnen zu schärfen, statt uns nur auf Probleme und Defizite zu konzentrieren. Sie kann uns unterstützen, gemeinsam mit den Betroffenen passende Unterstützungsangebote zu entwickeln und ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.
Bislang spielt die soziale Diagnostik eine oft unterschätzte Rolle. Sie kann das Fundament für zielgerichtete Unterstützungsmaßnahmen bilden und es ermöglichen, die vielschichtigen Lebenssituationen unserer Klient*innen strukturiert zu erfassen. Ganz in diesem Sinne in die Zukunft blickend, ist soziale Diagnostik kein abgeschlossenes Konzept, sondern ein "unabgeschlossenes Großprojekt" (Buttner u.a., 2020, S. 11), gewissermaßen in der Beta-Phase.
Die Komplexität der individuellen und sozialen Zusammenhänge, mit denen wir in unserem Arbeitsalltag konfrontiert sind, erfordert eine differenzierte Herangehensweise. Schnelle, oberflächliche Einschätzungen können mehr schaden als nutzen. Kunstreich geht sogar so weit, vorschnelle Diagnosen als "üble Nachrede" zu bezeichnen (Kunstreich, 2004, S. 26). Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen und reflektierten Diagnostik.
Auch im psychiatrischen Kontext zeigen sich die Grenzen klassischer Diagnosesysteme. Marshall Rosenberg, der Erfinder der Gewaltfreien Kommunikation, beobachtete in psychiatrischen Einrichtungen oft eine übermäßige Fokussierung auf Diagnosen zu Lasten einer ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Er schlägt einen alternativen Ansatz vor, der sich auf Gefühle und Bedürfnisse konzentriert: "Was fühlt diese Person? Was braucht sie oder er?" (Rosenberg, 2016, S. 191). Dieser Ansatz ermöglicht es uns, den Menschen hinter der Diagnose wahrzunehmen und seine individuellen Bedürfnisse zu verstehen.
Im Vergleich zu anderen Disziplinen wie der Medizin oder Psychotherapie arbeiten wir in der Sozialen Arbeit in deutlich komplexeren und weniger planbaren Umgebungen. Wir sind mit "Problemen der Unübersichtlichkeit und der Unvorhersehbarkeit konfrontiert" (Pantuček, 2019, S. 13). Dies macht eine eigene soziale Diagnostik unerlässlich, die sich von medizinischen oder psychologischen Diagnosemodellen unterscheidet und den besonderen Anforderungen unseres Arbeitsfeldes gerecht wird.
Letztendlich geht es darum, eine Balance zu finden zwischen strukturierter Erfassung und individueller Betrachtung, zwischen fachlicher Einschätzung und empathischem Verstehen, zwischen Bestandsaufnahme und Zukunftsplanung. Nur so können wir unseren Klient*innen die bestmögliche Unterstützung bieten und ihnen helfen, ihre Potenziale zu entfalten und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Diagnose und Diagnostik
Ein Wort zu den Begriffen: Diagnose und Diagnostik sind nicht dasselbe. Der Hauptunterschied zwischen beiden liegt in ihrer Funktion und ihrem Umfang. Während die Diagnose das Endergebnis darstellt, beschreibt die Diagnostik den Weg dorthin. Eine Diagnose ist eine einzelne, abschließende Feststellung, wohingegen die Diagnostik eine Vielzahl verschiedener Methoden und Verfahren umfasst. Zeitlich betrachtet steht die Diagnose am Ende des diagnostischen Prozesses, während die Diagnostik mit der ersten Untersuchung beginnt und sich über den gesamten Erkenntnisprozess erstreckt.
In der Praxis der Sozialen Arbeit ist es wichtig, beide Aspekte zu berücksichtigen. Die Diagnostik ermöglicht es, ein umfassendes Bild der Situation eines Klienten zu gewinnen und verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Sie bildet die Grundlage für eine fundierte Einschätzung und die Entwicklung geeigneter Interventionsstrategien. Die Diagnose wiederum fasst die Erkenntnisse aus dem diagnostischen Prozess zusammen und bietet eine Basis für die weitere Planung und Durchführung von Hilfsmaßnahmen.
Es ist wichtig zu betonen, dass sowohl die Diagnostik als auch die daraus resultierende Diagnose in der Sozialen Arbeit stets als vorläufig und veränderbar betrachtet werden sollten. Die Lebenssituationen von Menschen sind komplex und dynamisch, sodass eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Einschätzungen erforderlich sind. Zudem sollte der diagnostische Prozess in der Sozialen Arbeit stets partizipativ gestaltet werden, indem die Klienten aktiv einbezogen und ihre Perspektiven und Ressourcen berücksichtigt werden.
Probleme einer Diagnose in der Sozialen Arbeit
In der Sozialen Arbeit spielen Diagnosen eine problematische Rolle, deren wir uns bewusst sein müssen. Du kennst sicher die Situation: Ein Klient kommt zu dir, und du hast bereits seine Diagnose vor Augen. Doch was bedeutet das für deine Arbeit und vor allem für den Menschen, der vor dir sitzt?
Nehmen wir als Beispiel einen Menschen mit der Diagnose “Schizophrenie“. Menschen mit dieser Diagnose erleben oft massive Vorurteile und soziale Ausgrenzung. Sie werden als "verrückt" oder "gefährlich" abgestempelt, obwohl die Realität viel komplexer ist. Diese Stigmatisierung kann zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung werden, bei der Betroffene sich immer mehr zurückziehen und isolieren.
Oder der Fall einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Wie oft hast du schon Sätze gehört wie "Der borderlinet schon wieder"? Diese Fixierung auf die Diagnose kann dazu führen, dass wir das individuelle Verhalten und die Bedürfnisse des Menschen aus den Augen verlieren und auch uns unserer professionellen Verantwortung entziehen. Wir interpretieren jede Handlung durch die Brille der Diagnose und übersehen dabei schnell mal wichtige Fortschritte, alternative Erklärungen oder lösungsorientierte Handlungsmöglichkeiten.
Die Gefahr besteht darin, dass wir unseren Klient*innen unbewusst die Möglichkeit zur Weiterentwicklung absprechen. Wenn wir jedes Verhalten als Symptom der Diagnose deuten, wie soll dann Veränderung stattfinden? Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass eine Diagnose nur eine Momentaufnahme ist und nicht das gesamte Wesen eines Menschen definiert.
Einerseits können Diagnosen hilfreich sein, um Verhaltensweisen einzuordnen und passende Unterstützungsangebote zu finden. Andererseits dürfen wir nie vergessen, dass vor uns ein einzigartiger Mensch mit individuellen Erfahrungen, Stärken und Herausforderungen sitzt. Unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen ganzheitlich wahrzunehmen und gemeinsam Wege zur Verbesserung seiner Lebenssituation zu finden.
Statt uns auf Etiketten zu versteifen, sollten wir den Fokus auf die Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten unserer Klient*innen legen. Nur so können wir wirklich unterstützend wirken und Stigmatisierung abbauen. Denn am Ende des Tages geht es in der Sozialen Arbeit darum, Menschen in ihrer Einzigartigkeit zu sehen und sie auf ihrem individuellen Weg zu begleiten.
Kriterien einer sozialen Diagnostik
Anders als bei rein medizinischen oder psychologischen Diagnosen berücksichtigt die soziale Diagnostik die komplexen Wechselwirkungen zwischen dem Individuum und seiner sozialen Umgebung. Sie erfasst nicht nur individuelle Probleme, sondern auch gesellschaftliche Faktoren, die zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Schwierigkeiten beitragen können. Dabei geht es darum, die Ressourcen und Potenziale im sozialen Netzwerk der Klienten zu erkennen und für den Hilfeprozess nutzbar zu machen. Die soziale Diagnostik ermöglicht es Sozialarbeiter*innen, ein umfassendes Bild der Lebenssituation ihrer Klienten zu gewinnen und passgenaue Unterstützungsangebote zu entwickeln.
Die soziale Diagnostik ist ein vielseitiges Instrument, das uns hilft, die Lebenssituation unserer Klient*innen ganzheitlich zu erfassen und gemeinsam Lösungswege zu finden. Doch was macht diese Form der Diagnostik so besonders?
Ein Kernmerkmal ist ihre Multiperspektivität. Wir betrachten die Situation nicht nur aus einem Blickwinkel, sondern berücksichtigen verschiedene Einflussfaktoren. Röh (2020) bringt es auf den Punkt: "Soziale Diagnostik (...) begreift das Soziale in einem umfassenden, multiperspektivischen Sinn" (S. 103). Das bedeutet, wir schauen uns nicht nur die offensichtlichen Probleme an, sondern auch das soziale Umfeld, die Ressourcen und die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Lebensbereichen.
Ebenso wichtig ist der dialogische Charakter. Wir sehen unsere Klient*innen als Expert*innen ihrer eigenen Situation. Pantuček (2006) unterstreicht: "Eine Soziale Diagnostik, die den Charakter der Sozialarbeit als dialogische Profession aushebelt, wäre kontraproduktiv. Die Sicht der KlientInnen von ihrer Situation, deren Eigendiagnose, muss weiterhin pragmatischer Ausgangspunkt von Beratungsstrategien bleiben" (S. 4). Das heißt, wir hören aktiv zu und beziehen die Perspektiven und Einschätzungen unserer Klient*innen in den gesamten Prozess ein.
Wir betrachten die soziale Diagnostik als einen kontinuierlichen und sich fortwährend weiterentwickelnden Vorgang. Dieser ist nicht isoliert, sondern fest eingebettet in den gesamten Ablauf der Beratung, welcher selbst durch seine prozesshafte Natur gekennzeichnet ist (Fischer, 2020, S. 10). Unsere Erkenntnisse sind also keine in Stein gemeißelten Wahrheiten, sondern Momentaufnahmen, die wir immer wieder überprüfen und anpassen müssen.
Ein weiterer spannender Aspekt ist der experimentelle Charakter, so Pantuček (2019): "Was also liegt auch aus Gründen der Arbeitsökonomie näher, als ein ohnehin nicht absehbares Ende des Verfahrens der Informationsbeschaffung gar nicht erst abzuwarten, sondern parallel zum Prozess der Diagnose mit der aktiven Arbeit zur Problemlösung zu beginnen. Man bekommt dadurch ein zusätzliches und durchaus mächtiges Instrument der Diagnose in die Hand, nämlich das Experiment" (S. 14). Wir warten also nicht, bis wir alle Informationen haben, sondern beginnen schon früh mit konkreten Unterstützungsangeboten. Die Reaktionen darauf liefern uns wiederum wertvolle diagnostische Erkenntnisse.
Schließlich ist es wichtig, dass wir uns unserer eigenen Subjektivität bewusst sind. Fischer (2020) betont: "Soziale Diagnostik bekennt sich somit zur Subjektivität und tut nicht so, als ob sie die allein 'richtigen' Aussagen findet" (S. 9). Wir reflektieren also ständig unsere eigenen Annahmen und Interpretationen und sind offen für neue Perspektiven.
Diese Merkmale machen die soziale Diagnostik zu einem flexiblen und leistungsfähigen Werkzeug in unserer täglichen Arbeit. Sie ermöglicht es uns, gemeinsam mit unseren Klient*innen ein tiefes Verständnis ihrer Situation zu entwickeln und maßgeschneiderte Unterstützung anzubieten.
Instrumente
Für die soziale Diagnostik steht eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung, die sich in einer eigenen Systematik gruppieren lassen (Pantuček, 2019 und Buttner, 2020):
Sichtdiagnosen | z.B. Hausbesuche, strukturierte Stadteilerkundung
Kurzdiagnosen | z.B. Vorläufige Diagnose auf der Basis vorhandener Daten
Notationssysteme | z.B. Genogramme, Zeitstrahl, Problembeschreibungs- oder Zielplanungsraster, Drei Häuser, Silhouette
Netzwerkdiagnostik | z.B. Netzwerkarten, Ecomaps, Personallisten
Biografische Diagnostik | z.B. Biografischer Zeitbalken, Lebenspanorama, Erwachsenenbindungsinterview
Lebensweltdiagnostik | z.B. Inklusions-Chart, individuelle Sozialraumanalyse, Säulen der Identität
Ressourcendiagnostik | z.B. Ressourcenkarten, Ressourceninterview
Klassifikationssysteme | z.B. PIE, ICF
Kooperative und „Blackbox“ Diagnostik | z.B. Skalierungsfragen, Familienkonferenzen
Ein Schlüsselinstrument ist das Problembeschreibungs- bzw. Mehrperspektivenraster. Es ermöglicht, die Situation aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und zu erfassen. Pantuček (2019) unterstreicht die Bedeutung dieses Ansatzes: "Die Problembeschreibungen selbst konstituieren den Bedingungs- und Möglichkeitsraum des Falles, sind also Teile quasi-materieller Realität. Diese Perspektiven vorerst einmal wahrzunehmen und 'festzuhalten', ist für die fachgerechte Bearbeitung des Falles erforderlich" (S. 176). Durch die Anwendung dieses Instruments können Fachkräfte ein umfassendes Bild der Situation gewinnen und mögliche Handlungsansätze identifizieren.
Arbeitshilfe Mehrperspektivenraster:
https://www.pantucek.com/diagnose/mat/mehrperspektivenraster.pdf
Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist die Netzwerkanalyse. Sie ermöglicht es, das soziale Umfeld der Klient*innen zu visualisieren und zu analysieren. Pantuček (2006) bezeichnet sie sogar als potenzielle "Königsdisziplin der sozialen Diagnostik" und erklärt: "Wenn es denn eine Königsdisziplin der sozialen Diagnostik geben sollte, dann ist das wohl die Netzwerkanalyse. Für die Einzelfallarbeit können mit Instrumenten wie der Netzwerkkarte die sozialen Beziehungen von Personen anschaulich modelliert werden" (S. 7). Die Netzwerkanalyse kann wertvolle Einblicke in Unterstützungssysteme und mögliche Ressourcen liefern.
Arbeitshilfe Netzwerkkarte:
https://www.pantucek.com/diagnose/netzwerkkarte/netzwerkkarte_manual.pdf
Der biografische Zeitbalken stellt ein drittes wichtiges Instrument dar. Er hilft, die Lebensgeschichte der Klient*innen strukturiert zu erfassen und einzuordnen. Pantuček (2019) erläutert: "Der biografische Zeitbalken ordnet die Erzählungsbestandteile in einer Übersicht – einer mehrdimensionalen Timeline – an und fragt auch nach der genauen zeitlichen Verortung, nach dem vorerst Unerzählten" (S. 223). Dieses Instrument kann dazu beitragen, Zusammenhänge zu erkennen und Entwicklungen nachzuvollziehen.
Arbeitshilfe biografischer Zeitbalken:
https://www.pantucek.com/soziale-diagnostik/verfahren/231-biographischer-zeitbalken.html
Es ist wichtig zu betonen, dass diese Instrumente nicht nur der Informationssammlung dienen. Sie können bereits Teil des Interventionsprozesses sein, indem sie Reflexionen anregen und neue Perspektiven eröffnen. Durch die gemeinsame Arbeit mit diesen Werkzeugen können Klient*innen und Fachkräfte ein tieferes Verständnis für die Situation entwickeln und gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten.
Fazit
In der täglichen Arbeit mit Menschen, die besondere Herausforderungen im Leben meistern, kann die soziale Diagnostik eine zentrale Rolle spielen. Sie kann uns helfen, die Lebenssituation unserer Klient*innen besser zu verstehen und passende Unterstützungsangebote zu entwickeln. Doch wie bei vielen Werkzeugen in unserem Berufsfeld gibt es noch Raum für Verbesserungen.
Stellen wir uns vor, wir hätten einen Werkzeugkasten, in dem jedes Werkzeug etwas anders aussieht und funktioniert, und niemand weiß genau, wie es zu bedienen ist. So ähnlich verhält es sich derzeit mit der sozialen Diagnostik. Fischer (2020) fasst die Situation gut zusammen: "Es existiert eine Vielfalt von Konzepten, wobei bis dato kein einheitlicher konzeptioneller Ansatz realisiert werden konnte" (S. 4). Das macht es für uns in der Praxis nicht immer einfach, einheitlich und vergleichbar zu arbeiten. Und vielleicht ist das auch gar nicht so notwendig …
Auch ist mit Fischer (2020) zu bedenken: "Gegenwärtig fehlt noch an vielen Stellen der empirische Beleg für bereits zahlreiche erprobte Handlungspraxen" (S. 6). Mit anderen Worten: Wir wissen oft aus Erfahrung, dass etwas funktioniert, aber wir können es nicht immer wissenschaftlich belegen. Das ist, als würden wir ein Rezept immer wieder erfolgreich kochen, ohne die genauen Mengenangaben zu kennen.
Wie können wir also unsere "Rezepte" verbessern? Fischer (2020) hat dazu einen Vorschlag: "Wünschenswert wäre eine weitere Ausdifferenzierung der Erfassung sozialer Kriterien über die Koordinaten psychosozialer Diagnostik und Intervention hinaus (...) sowie eine Systematisierung in interne und externe Faktoren" (S. 17). Das bedeutet, wir sollten genauer hinschauen, welche Zutaten wir verwenden und wie sie zusammenwirken - sofern das in der Sozialen Arbeit in dieser Form überhaupt möglich ist. Denn wie eingangs bereits festgestellt: Im Vergleich zu anderen Disziplinen wie der Medizin oder Psychotherapie arbeiten wir in der Sozialen Arbeit in deutlich komplexeren und weniger planbaren Umgebungen.
Die soziale Diagnostik ist also wie ein Kochbuch, das wir gemeinsam schreiben und ständig verbessern. Jeder von uns trägt mit seinen Erfahrungen und Beobachtungen dazu bei. Indem wir unsere Methoden hinterfragen, systematisch erforschen und weiterentwickeln, können wir die Qualität unserer Arbeit stetig verbessern. So stellen wir sicher, dass wir auch in Zukunft die bestmögliche Unterstützung für unsere Klient*innen bieten können.
Braucht die Soziale Arbeit nun eine eigene Diagnostik? Ich würde antworten: Ja, aber nicht als starres System, sondern als flexibles Werkzeug, das uns hilft, die Lebenswelten unserer Klient*innen besser zu verstehen und gemeinsam mit ihnen Lösungswege zu erarbeiten. Eine solche Diagnostik muss den dialogischen Charakter unserer Profession widerspiegeln und die Expertise der Betroffenen einbeziehen. Sie sollte uns dabei unterstützen, sowohl individuelle als auch strukturelle Faktoren zu berücksichtigen und die Ressourcen und Potenziale unserer Klient*innen in den Vordergrund zu stellen. Gleichzeitig müssen wir kritisch reflektieren, wie wir diagnostische Instrumente einsetzen und welche Auswirkungen sie auf unsere Arbeit und unsere Klient*innen haben. Nur so können wir sicherstellen, dass soziale Diagnostik nicht zur Stigmatisierung beiträgt, sondern tatsächlich zu einer verbesserten Unterstützung und Stärkung der Menschen führt, mit denen wir arbeiten.
Literatur
Buttner u.a. (Hrsg., 2020): Handbuch Soziale Diagnostik. Perspektiven und Konzepte für die Soziale Arbeit. Berlin.
Buttner, Peter u.a. (2020): Soziale Diagnostik. Eine Einführung. In: Buttner u.a. (Hrsg.): Handbuch Soziale Diagnostik. Perspektiven und Konzepte für die Soziale Arbeit. Berlin.
Fischer, Margret u.a. (2020): Wozu Soziale Diagnostik? Begriffsverständnis, Annahmen, Forschungsstand und Praxisbezug. In: Beratung Aktuell. Heft 3, S. 4 – 22.
Kunstreich, Timm u.a. (2004): Dialog statt Diagnose. In: Heiner, Maja (Hrsg.): Diagnostik und Diagnosen in der Sozialen Arbeit. Ein Handbuch. Berlin, S. 26 – 39.
Pantuček, Peter (2006): Soziale Diagnostik. In: Klinische Sozialarbeit. Zeitschrift für Psychosoziale Praxis und Forschung. Heft 2, S. 4 – 7.
Pantuček, Peter (2019): Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. Göttingen.
Röh, Dieter (2020): Theoretische Einbettung der Sozialen Diagnostik. In: Buttner u.a. (Hrsg.): Handbuch Soziale Diagnostik. Perspektiven und Konzepte für die Soziale Arbeit. Berlin.