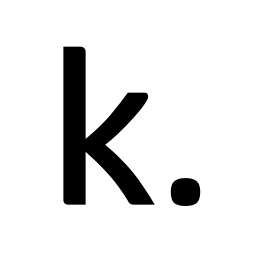Erinnerungstheater
Wer spinnt hier eigentlich - ich oder mein Gehirn?
Vielleicht kennt Ihr die Situation: Du erinnerst Dich ganz genau an einen Konflikt vor ein paar Wochen, hast das auch mit ein paar Kolleg*innen besprochen und ihr seid der Meinung, da hat eine Kolleg*in einfach eine rote Linie überschritten. Mit jedem Gespräch werdet Ihr wütender, bis es in der nächsten Teambesprechung zum Eklat kommt. Die Kolleg*in behauptet dann auch noch, es wäre alles anders gewesen, als wir es sagen.
Was passiert da? Sagt die Kolleg*in die Unwahrheit oder hat ein schlechtes Gedächtnis? Oder kannst Du Dich nicht mehr richtig auf Dein Gedächtnis verlassen? Wenn Du zeitnah Notizen gemacht hast, dann ist das ein super “Reality Check”. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Du in Deinen eigenen Notizen etwas ganz anderes liest, als woran Du Dich so lebhaft erinnerst. Was ist da los? Was kannst Du dagegen tun?
Das menschliche Gedächtnis ist ein komplexes System, das bei der Speicherung und dem Abruf von Erinnerungen verschiedenen Einflüssen und Verzerrungen unterliegen kann. Wenn wir Ereignisse nicht aufschreiben, sondern uns nur darauf verlassen, sie zu erinnern, können tatsächlich Veränderungen in der Wahrnehmung und Erinnerung auftreten. Dies gilt besonders für größere oder emotional aufgeladene Ereignisse.
Verzerrung von Erinnerungen
Unser Gehirn neigt dazu, Erinnerungen im Laufe der Zeit zu verändern und anzupassen. Dieser Prozess wird als Rekonstruktion bezeichnet. Dabei können Ereignisse in der Erinnerung tatsächlich "größer" oder bedeutsamer erscheinen, als sie ursprünglich waren. Dies geschieht aus mehreren Gründen:
Emotionale Intensität: Emotional aufgeladene Ereignisse werden oft intensiver erinnert und können in der Wahrnehmung verstärkt werden.
Selektive Wahrnehmung: Unser Gehirn filtert Informationen und speichert bevorzugt jene, die zu unseren bestehenden Überzeugungen passen.
Lücken füllen: Das Gehirn neigt dazu, Lücken in der Erinnerung mit plausiblen, aber möglicherweise nicht akkuraten Details zu füllen.
Einfluss der Gruppendynamik
Die Gruppendynamik spielt eine bedeutende Rolle bei der Formung und Verstärkung von Erinnerungen:
Kollektives Gedächtnis: In Gruppen entsteht ein gemeinsames Verständnis von Ereignissen, das die individuellen Erinnerungen beeinflussen kann.
Soziale Verstärkung: Durch wiederholtes Erzählen und gegenseitiges Bestätigen können Erinnerungen in der Gruppe verstärkt und möglicherweise verzerrt werden.
Konformitätsdruck: Individuen können ihre Erinnerungen unbewusst an die der Gruppe anpassen, um dazuzugehören.
Wissenschaftliche Perspektive
Aus neurowissenschaftlicher Sicht lassen sich folgende Prozesse beobachten:
Neuroplastizität: Jeder Abruf einer Erinnerung führt zu einer Neukonsolidierung, wobei die Erinnerung leicht verändert werden kann.
Amygdala-Aktivierung: Bei emotionalen Ereignissen ist die Amygdala stärker aktiviert, was zu intensiveren und möglicherweise verzerrten Erinnerungen führt.
Präfrontaler Kortex: Dieser Bereich ist für die Kontextualiserung von Erinnerungen zuständig und kann durch Gruppendiskussionen beeinflusst werden.
Hippocampus: Spielt eine zentrale Rolle bei der Bildung und dem Abruf von Erinnerungen und ist anfällig für Verzerrungen durch wiederholten Abruf und soziale Einflüsse.
Und nun?
Stell Dir nun noch einmal vor, Du sitzt in einer Teambesprechung und plötzlich kommt dieser Konflikt von vor ein paar Wochen zur Sprache. Du bist Dir sicher, dass Du Dich genau erinnerst, wie es war. Aber ist das wirklich so? Unser Gehirn ist kein perfekter Speicher, sondern eher wie ein kreativer Geschichtenerzähler. Es formt und verändert unsere Erinnerungen ständig, besonders wenn starke Gefühle im Spiel sind oder wenn wir oft darüber reden. Das kann dazu führen, dass Du Dich an Dinge "erinnerst", die so gar nicht passiert sind, oder dass Du bestimmte Aspekte überbewertst.
Wenn Du mit Klient*innen arbeitest, ist es besonders wichtig, Dir dieser Tücken des Gedächtnisses bewusst zu sein. Eine falsche Erinnerung oder Behauptung kann schwerwiegende Folgen haben und im schlimmsten Fall sogar ungerecht sein. Stell Dir vor, Du würdest aufgrund einer verzerrten Erinnerung eine falsche Einschätzung über eine*n Klient*in treffen. Das könnte deren Vertrauen in Dich und Deine Arbeit nachhaltig schädigen. Deshalb ist es so wichtig, dass Du Dich nicht nur auf Dein Gedächtnis verlässt, sondern auch andere Quellen nutzt, um Deine Erinnerungen zu überprüfen.
Was kannst Du also tun? Mach Dir am besten zeitnah Notizen zu wichtigen Ereignissen oder Gesprächen. Diese Aufzeichnungen können Dir später als "Reality Check" dienen. Wenn Du merkst, dass Deine Erinnerung von Deinen Notizen abweicht, sei offen dafür, Deine Sichtweise zu hinterfragen. Sprich auch mit Deinen Kolleg*innen darüber, wie trügerisch Erinnerungen sein können. Gemeinsam könnt Ihr Strategien entwickeln, um objektiver zu bleiben und vorschnelle Urteile zu vermeiden. Denk immer daran: Eine offene, selbstkritische Haltung und die Bereitschaft, die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, sind entscheidend für eine faire und professionelle Arbeit mit Menschen.